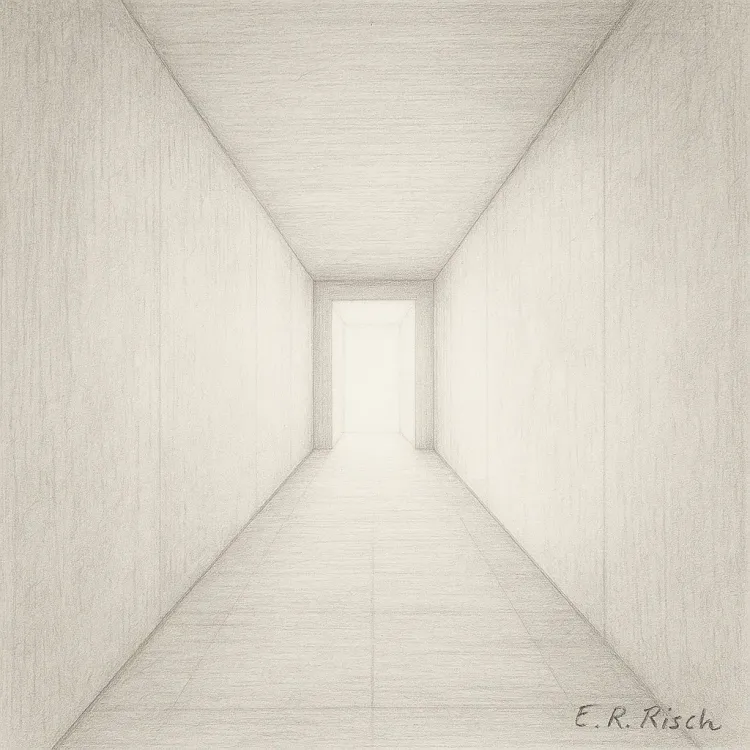Der Irrglaube Sanierungsgewinn
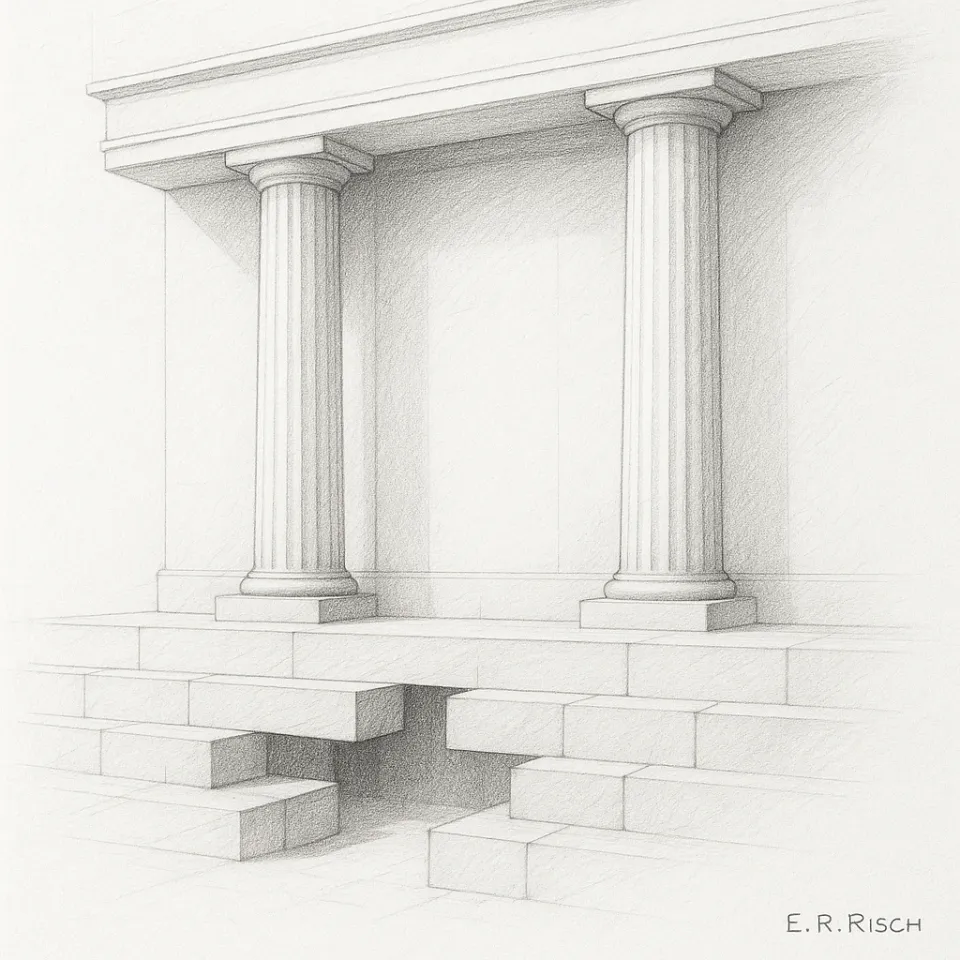
Wie steuerliches Wunschdenken Sanierungen torpediert – und warum niemand darüber spricht
Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis von Restrukturierungen, zwischen Realität, Hoffnung und stillschweigendem Einverständnis.
„Ist ja steuerfrei, hat der Steuerberater gesagt.“
Diesen Satz höre ich öfter, als mir lieb ist.
Meist kommt er in einer Phase, in der das Unternehmen gerade aufatmet: Ein Schuldenschnitt wurde vereinbart, die Banken geben Luft, und plötzlich steht da ein ordentlicher außerordentlicher Ertrag in der GuV.
Die Stimmung kippt dann, wenn man fragt:
„Wurde geprüft, ob das wirklich ein steuerfreier Sanierungsgewinn ist?“
Und: „Welche Rolle spielt der Verzicht eigentlich im Gesamtkonzept der Sanierung?“
Dann wird es still.
Oder fahrig.
Oder: „Wird schon passen – das hat der Steuerberater so eingeordnet.“
Warum ich das schreibe
Ich bin kein Steuerberater. Kein Wirtschaftsprüfer. Kein Jurist.
Aber ich begleite seit Jahren Sanierungen, Beteiligungen und Sonderlagen – oft mitten in der Krise. Und ich erlebe regelmäßig, wie gut gemeinte Vereinfachungen genau das torpedieren, was eigentlich Stabilität bringen soll.
Der „Sanierungsgewinn“ ist so eine Vereinfachung.
Ein Begriff, der Hoffnung verspricht – aber in der Praxis oft für neue Risiken sorgt.
Nicht, weil die Regelung an sich falsch wäre.
Sondern weil sie falsch verstanden, falsch verwendet und zu selten hinterfragt wird.
Der gefährlichste Satz in der Sanierung:
„Das ist steuerfrei – steht doch im Gesetz.“
Das Problem ist nicht der Steuerberater, der das sagt.
Das Problem ist, dass alle nicken – und keiner nochmal nachfragt.
Die steuerliche Regelung (§ 3a EStG) ist komplex, an Bedingungen geknüpft und verlangt saubere Dokumentation.
Aber in der Praxis wird sie oft so genutzt:
- Forderungsverzicht → Ertrag → Bilanz erholt sich → Steuerfreiheit angenommen → Sanierung „gelungen“.
Nur:
Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind – zum Beispiel keine echte Sanierungsabsicht der Gläubiger vorliegt oder die Sanierungsfähigkeit nie geprüft wurde – kippt das Ganze. Dann drohen:
- Steuernachzahlungen zu einem Zeitpunkt, an dem die Liquidität fehlt.
- Haftungsrisiken für Geschäftsführer.
- Ärger mit Banken, Gläubigern, Gesellschaftern.
- Im schlimmsten Fall: Insolvenz wegen eines scheinbaren Erfolgs.
Der „Gewinn“ ist selten einer – und fast nie liquide
Das, was als Sanierungsgewinn verbucht wird, ist ein rechnerischer Gewinn. Kein Geld auf dem Konto. Kein operativer Fortschritt.
Und doch führt er oft zu zwei gefährlichen Illusionen:
- Bilanzielle Gesundung.
Plötzlich ist das Eigenkapital nicht mehr negativ. Das sieht gut aus – aber stabilisiert nichts, wenn operativ weiter Verluste laufen. - Gefühlter Erfolg.
Der Druck sinkt, der Fokus auf echte Veränderung schwindet. Alle hoffen: „Jetzt wird's schon.“ Aber Hoffnung ersetzt keine Sanierung.
Was ich in der Praxis immer wieder sehe:
Der Steuerberater meint es gut.
Er will dem Unternehmen helfen, Zeit gewinnen, Optimismus erzeugen. Und stützt sich dabei auf ein Gesetz, das in der Theorie klare Bedingungen hat – in der Praxis aber oft auf Lücken stößt.
Der Wirtschaftsprüfer sagt oft gar nichts.
Oder er weist darauf hin, dass das Eigenkapital wieder positiv sei – was formal stimmt, aber nichts darüber aussagt, ob das Unternehmen überlebensfähig ist.
Der Jurist prüft vielleicht das Sanierungskonzept – aber selten die Steuerwirkung.
Und wenn er Bedenken äußert, werden sie als Formalien abgetan.
Und der Geschäftsführer?
Der glaubt, dass alles in Ordnung ist. Schließlich arbeiten ja alle dran.
Ein reales Beispiel (leicht anonymisiert):
Ein produzierendes Unternehmen aus Süddeutschland hatte einen Schuldenstand, der nicht mehr tragfähig war. Die Banken ließen mit sich reden – ein Verzicht von knapp 2 Mio. € wurde gewährt. Die Steuerberaterin buchte den außerordentlichen Ertrag ein – „Sanierungsgewinn, klar – steuerfrei“.
Niemand prüfte systematisch:
- ob die Sanierungsfähigkeit dokumentiert war,
- ob ein abgestimmtes Gesamtkonzept vorlag,
- ob die Gläubiger sich aus Sanierungsabsicht oder reinem Eigeninteresse zurückzogen.
Als das Unternehmen ein Jahr später erneut in Schwierigkeiten geriet, prüfte das Finanzamt – und erkannte die Steuerfreiheit nicht an.
Ergebnis: Sechsstellige Nachforderung.
Liquidität? Nicht vorhanden.
Vertrauen bei Gläubigern? Erodierte.
Ergebnis: Insolvenz.
Was daran so bitter ist: Es war vermeidbar.
Nicht, weil man alles hätte wissen müssen.
Sondern, weil man nicht alles hätte glauben dürfen.
Was ich mir häufiger wünschen würde
- Dass Steuerberater den Mut haben, Mandanten nicht zu beruhigen, sondern zu konfrontieren: „Ob das steuerfrei ist, hängt nicht nur vom Gesetz ab – sondern von euch.“
- Dass Wirtschaftsprüfer klarer sagen, was in der Bilanz steht – und was nicht: „Die Eigenkapitalquote ist rechnerisch besser – aber nicht wirtschaftlich gesund.“
- Dass Juristen mit den anderen Berufsgruppen sprechen, bevor sie Konzepte freigeben.
Und dass wir als Begleiter nicht einfach übernehmen, was andere sagen – sondern hinterfragen, was davon im Ernstfall trägt.
Mein Fazit aus verschiedenen Restrukturierungen:
Ein Sanierungsgewinn ist kein Beweis für Erfolg.
Er ist ein Prüfstein für Reife.
Denn er zeigt:
Wird in Silos gearbeitet – oder interdisziplinär gedacht?
Geht es um kurzfristige Beruhigung – oder langfristige Tragfähigkeit?
Und ja – ich weiß, dass dieser Beitrag anecken kann.
Einige werden sagen:
„So einfach ist das nicht.“
Stimmt.
Andere vielleicht:
„Das passiert doch kaum noch.“
Vielleicht.
Aber ich habe es oft genug gesehen, um zu sagen: Doch. Es passiert noch. Zu oft.
Und wenn wir ehrlich sind, wissen das viele, die in der Krise beraten.
Deshalb dieser Beitrag.
Nicht als Vorwurf.
Sondern als Einladung, sich wieder auf das zu konzentrieren, worauf es in der Sanierung wirklich ankommt:
Klarheit. Verantwortung. Und den Mut, keine schnellen Antworten zu geben – wenn die Fragen eigentlich tiefere sind.