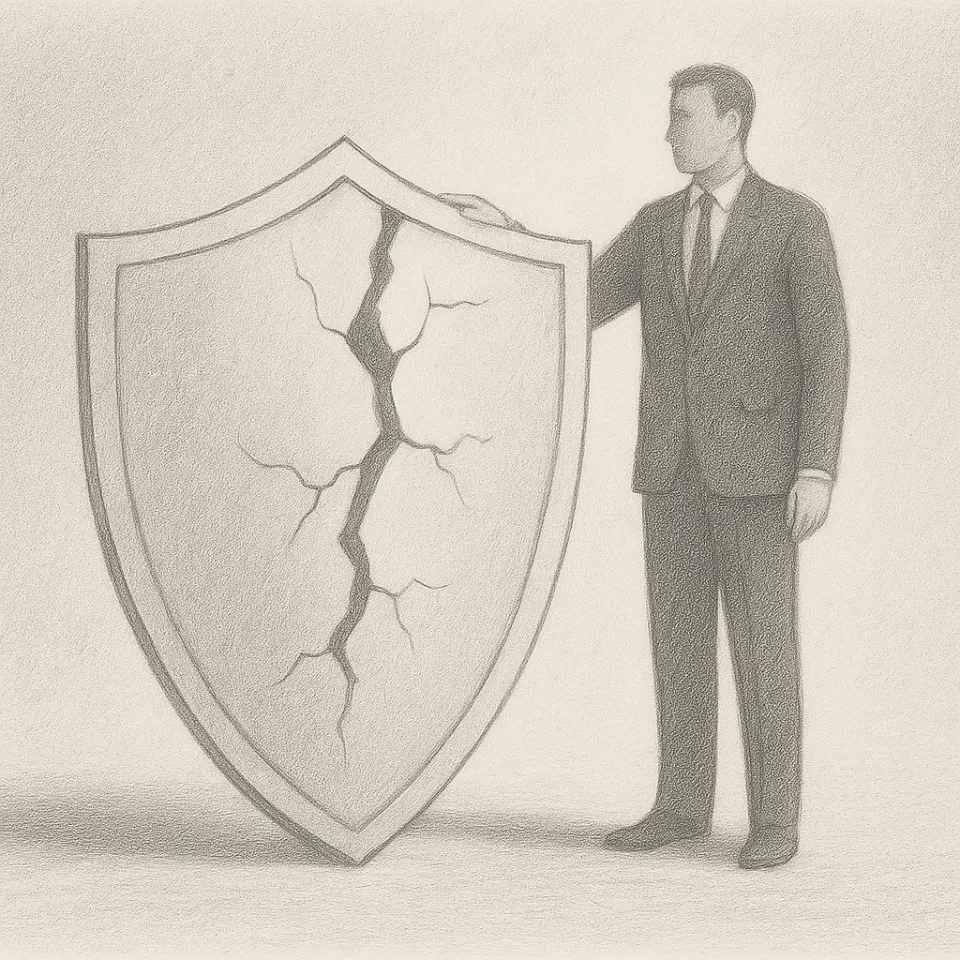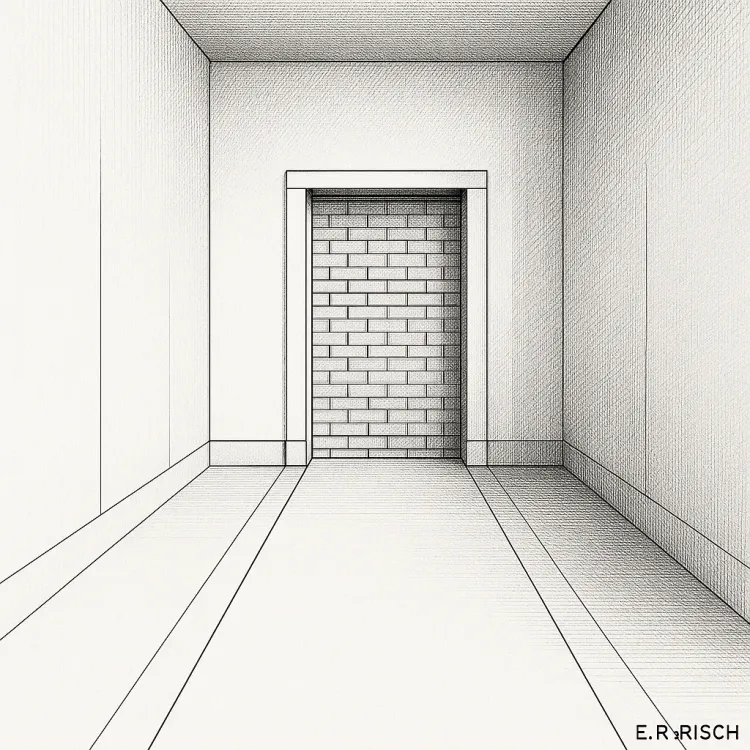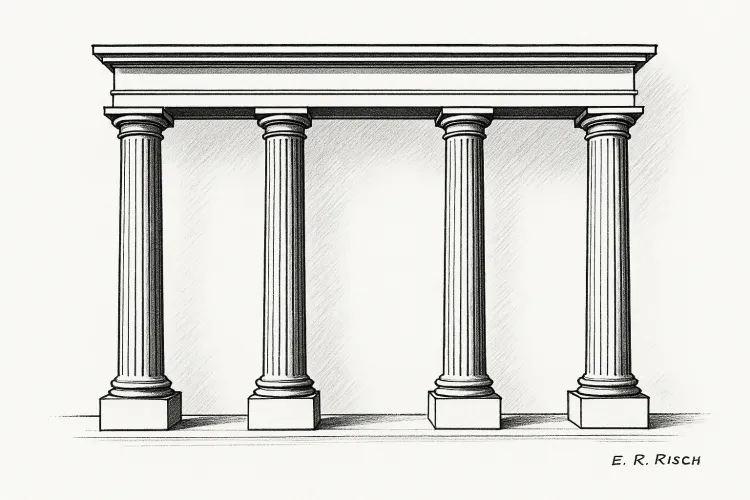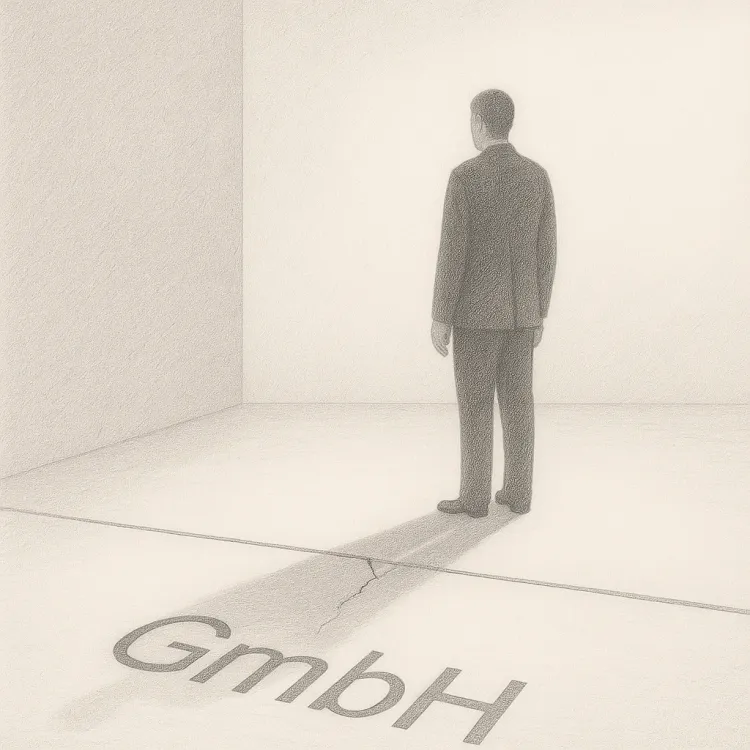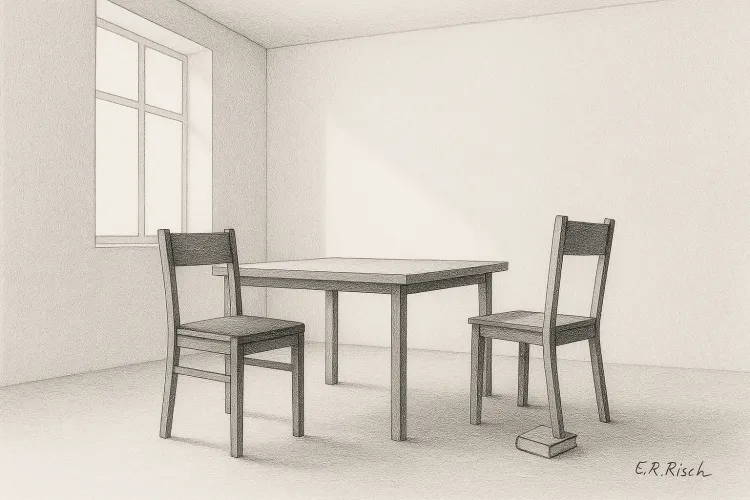Die Holding als Krisenschutz: Was viele Unternehmer falsch verstehen
Viele Unternehmer glauben, eine Holdingstruktur biete im Krisenfall Schutz. Doch das ist ein gefährlicher Irrtum: In Wahrheit kann sie zur Haftungsfalle werden. Der Beitrag zeigt, wann Holdings nützen – und wann sie brandgefährlich sind.