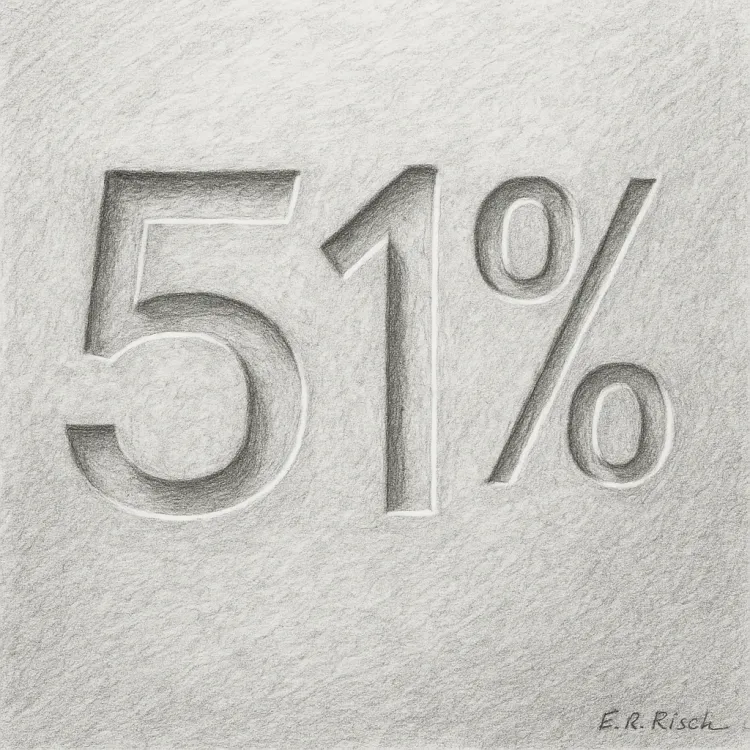Menschen wollen glauben, dass es gutgeht
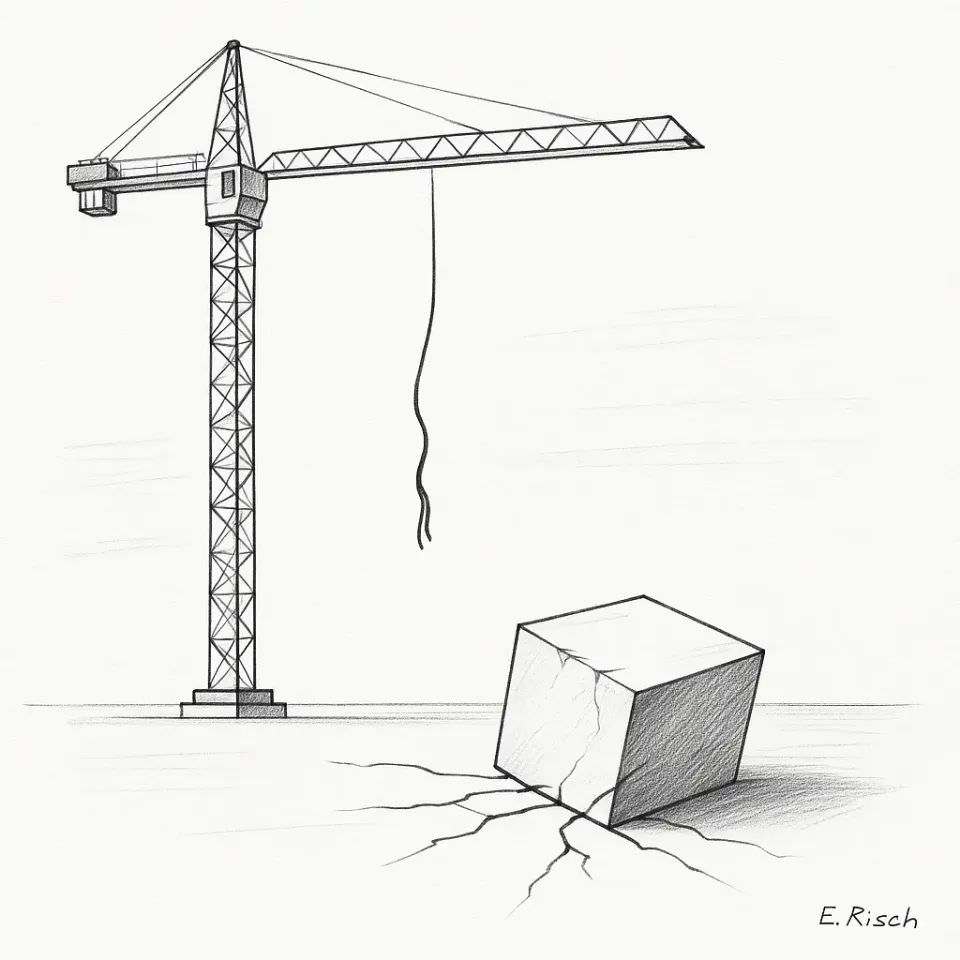
Im Frühjahr 2000 feierten Börsianer die Internetwirtschaft als Beginn einer neuen Zeitrechnung. Gewinne? Nebensache. Wachstum? Alles. „This time it’s different“, hieß es. Wenige Monate später platzte die Dotcom-Blase – und Milliardenwerte lösten sich in Luft auf.
2007 beschwichtigte US-Notenbankchef Ben Bernanke, die Turbulenzen am US-Immobilienmarkt seien „contained“. Ein Jahr später stand das globale Finanzsystem vor dem Abgrund.
2020 warnte die Financial Times vor Ungereimtheiten bei Wirecard. Die Reaktion? Journalisten und Analysten wurden als Schwarzmaler abgetan. Nur wenige Monate danach implodierte das Unternehmen – der größte Bilanzskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Und heute? Büros stehen leer, Bauprojekte stagnieren, Zinsen belasten Immobilienwerte. Dennoch klammern sich viele Eigentümer und Investoren an die Hoffnung, dass alles bald wieder so wird wie früher.
Diese Beispiele zeigen ein Muster: Menschen wollen glauben, dass es gutgeht.
Das ist zutiefst menschlich – und zugleich brandgefährlich.
Ein altes Sprichwort aus der arabisch-persischen Welt bringt es auf den Punkt:
„Vertraue auf Gott – aber binde dein Kamel fest.“
Überliefert als Hadith des Propheten Mohammed, mahnt es: Zuversicht ist erlaubt, ja notwendig – aber ohne Vorsorge bleibt sie naiv.
Hoffnung als Überlebensmechanismus
Psychologisch ist Hoffnung kein Fehler, sondern eine Ressource. Sie treibt uns an, Risiken einzugehen, neue Wege zu beschreiten, Krisen durchzustehen. Evolutionär betrachtet war Hoffnung überlebenswichtig. Ohne das Vertrauen, dass Jagd oder Ernte gelingen könnte, hätte niemand das Risiko auf sich genommen.
Doch in der modernen Wirtschaft wirkt Hoffnung wie ein verzerrender Filter. Sie führt dazu, dass wir Gefahren übersehen oder sie uns passend reden. Vier Phänomene erklären, warum wir Risiken oft unterschätzen – und warum Unternehmen immer wieder in dieselben Fallen tappen.
Optimismus-Bias – die schöne Zukunft
Der Optimismus-Bias sorgt dafür, dass wir die Wahrscheinlichkeit positiver Entwicklungen überschätzen. Unternehmer, Gründer, Investoren – sie alle sind besonders anfällig.
Die Dotcom-Blase ist das Paradebeispiel: Unternehmen ohne Gewinne wurden mit Milliarden bewertet, allein auf Basis künftiger Fantasien. Hoffnung verdrängte Realität. Als die Illusion platzte, waren viele Investoren überrascht – dabei war das Risiko längst sichtbar.
Psychologisch entsteht der Optimismus-Bias, weil unser Gehirn Belohnungen stärker gewichtet als Verluste. Das Dopamin-System springt an, wenn wir an Chancen denken – Risiken blenden wir schlicht aus.
Normalcy Bias – die Illusion der Normalität
Noch gefährlicher ist der Normalcy Bias, die Neigung, am Status quo festzuhalten. „Es ist noch immer gut gegangen“, lautet sein Mantra.
2008 führte er in die Katastrophe. Über Jahre hinweg wuchs die Überzeugung, Immobilienpreise könnten nicht gleichzeitig und flächendeckend fallen. Banken vertrauten ihren Modellen, Politiker beschwichtigten, Märkte wiegten sich in Sicherheit. Bis der Zusammenbruch kam – und zeigte, wie trügerisch Normalität sein kann.
Neurowissenschaftlich betrachtet schützt der Normalcy Bias unser Gehirn vor Überlastung. Menschen filtern Bedrohungen, die zu groß erscheinen, lieber aus, als sie zu akzeptieren. Das macht ihn so gefährlich: Er fühlt sich beruhigend an, während er in die Krise führt.
Cognitive Dissonance – der Schwarzmaler als Feindbild
Wenn Realität und Wunschdenken auseinanderfallen, entsteht kognitive Dissonanz. Das fühlt sich unangenehm an, weil zwei widersprüchliche Gedanken gleichzeitig im Kopf wirken. Um diese Spannung zu reduzieren, greifen wir auf Abwehrstrategien zurück.
Wirecard ist das drastischste Beispiel. Kritische Stimmen wurden diffamiert, statt ernst genommen. Wer Risiken benannte, wurde als Schwarzmaler abgestempelt – das half, das eigene Weltbild zu retten, bis es an der Realität zerbrach.
Auch im Unternehmensalltag ist das verbreitet. Der Controller, der Liquiditätslücken aufzeigt, der CRO, der zur Vorsicht mahnt – sie werden nicht selten als „Bremser“ abgetan. Nicht, weil sie falschliegen, sondern weil ihre Botschaft unangenehm ist.
Groupthink – die Dynamik der Runde
Besonders in Führungsteams wirkt ein weiteres Phänomen: Groupthink. Wenn alle nach Harmonie streben, werden kritische Stimmen unterdrückt. Zweifel gelten als illoyal, Widerspruch als negativ.
Das Ergebnis: Vorstände und Aufsichtsräte verstärken sich gegenseitig in der Hoffnung, dass alles gutgeht. Oft entsteht eine kollektive Illusion der Unverwundbarkeit – die Gruppe bestärkt sich selbst und blendet Risiken systematisch aus.
Die Geschichte kennt viele Beispiele dafür. Der Untersuchungsausschuss zu Wirecard dokumentierte, wie Aufsichtsrat und Prüfer trotz klarer Hinweise keine Konsequenzen zogen. In deutschen Industrieunternehmen finden sich ähnliche Muster, wenn Verluste schöngeredet werden, um die Fassade zu wahren. In der Immobilienkrise zeigt sich Groupthink heute, wenn Investorenrunden sich gegenseitig versichern, dass der Markt bald wieder „dreht“.
Der Absturz kommt dann überraschend – nicht weil niemand die Risiken gesehen hätte, sondern weil sie niemand auszusprechen wagte.
Overconfidence & Denial – die Immobilienkrise von heute
Übermut und Verdrängung prägen auch die aktuelle Immobilienkrise. Seit Corona stehen Büros leer, weil Homeoffice und hybride Modelle die Nachfrage dauerhaft verändert haben. Gleichzeitig explodierten Baukosten, während die Zinsen stiegen.
Viele Eigentümer und Entwickler halten trotzdem an alten Erwartungen fest. Sie rechnen Projekte schön, warten auf die Zinswende, hoffen auf eine Rückkehr zur Normalität. Die Psychologie nennt das Denial – Verleugnung.
Überdeutlich zeigt sich auch der Overconfidence Bias: Viele Investoren sind überzeugt, dass sie ihre Objekte schon durchfinanzieren werden. Doch Refinanzierungen scheitern, Leerstände bleiben – die Realität holt sie ein.
Besonders sichtbar wurde das zuletzt bei mehreren großen Projektentwicklungen in deutschen Großstädten, die stillgelegt wurden. Baustellen verharren im Rohbau, weil Finanzierungen geplatzt sind. Offiziell heißt es dann, man „prüfe Alternativen“. Psychologisch ist das nichts anderes als Verdrängung: den unausweichlichen Verlust hinauszögern.
Diese Immobilienkrise ist kein Strohfeuer, sondern ein Strukturwandel. Und genau deshalb ist sie psychologisch so schwer zu akzeptieren.
Die harte Brücke: Hoffnung trifft Recht
Psychologie erklärt, warum wir Risiken ausblenden. Aber im Unternehmenskontext reicht Psychologie nicht – hier greift das Recht.
Der Gesetzgeber hat Mechanismen geschaffen, die genau diese Verzerrungen korrigieren sollen:
- § 1 StaRUG verpflichtet Unternehmen zur Krisenfrüherkennung. Es ist die gesetzliche Form des „Kamelanbindens“.
- § 15a InsO zwingt Geschäftsführer zur Insolvenzantragstellung, wenn Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt. Wer zu lange hofft, begeht nicht nur einen Fehler – er riskiert persönliche Haftung.
- Liquiditätsplanung in drei Zeithorizonten (13 Wochen, 12 Monate, 24 Monate) ist nicht nur Best Practice, sondern oft die einzige Möglichkeit, frühzeitig Handlungsfähigkeit zu bewahren.
Die Rechtsprechung des BGH macht klar: Geschäftsführer haften persönlich, wenn sie in der Krise auf Zeit spielen. Psychologisch betrachtet ist das ein Schutzmechanismus – gegen die eigene Hoffnung.
Gerade hier wird auch die Rolle eines Chief Restructuring Officers (CRO) sichtbar. Ein CRO bringt Distanz in die Lage. Er ist nicht in die bisherigen Selbsttäuschungen verstrickt und kann den Spiegel vorhalten, den interne Führungskräfte oft scheuen. In vielen Sanierungsfällen ist genau das der Unterschied zwischen einer geordneten Restrukturierung und einem hektischen Absturz.
Psychologische Gegenbewegung: Räume für Realismus
Gute Führung bedeutet nicht, Hoffnung zu unterdrücken. Sie bedeutet, Räume zu schaffen, in denen Realismus erlaubt ist.
In der Praxis heißt das: kritische Stimmen hören, auch wenn sie unbequem sind. Mitarbeiter müssen Risiken ansprechen dürfen, ohne als „Schwarzmaler“ zu gelten. Externe Berater müssen nicht bejubelt, sondern ernst genommen werden. Führungsgremien müssen lernen, dass Dissens kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke ist.
Gerade in der Krise ist psychologische Sicherheit entscheidend: Nur wenn Menschen offen sprechen können, bevor es zu spät ist, lassen sich die notwendigen Schritte rechtzeitig einleiten.
Drei Lehren aus dem Sprichwort
Das persische Sprichwort fasst es perfekt zusammen: Vertrauen und Vorsorge gehören zusammen. Übertragen auf die Unternehmenspraxis heißt das:
Hoffnung ist notwendig – aber sie ersetzt kein Risikomanagement. Vorsorge schafft Sicherheit – für Zahlen, für Märkte, für Menschen. Hilfe rechtzeitig zu engagieren ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Verantwortung.
Denn niemand ist immun gegen psychologische Verzerrungen. Externe Stimmen helfen, den blinden Fleck zu erkennen.
Fazit: Das Kamel muss angebunden sein
Menschen wollen glauben, dass es gutgeht. Das ist menschlich – aber auch gefährlich. Die Dotcom-Blase, die Finanzkrise, Wirecard, Start-ups und die Immobilienkrise zeigen: Hoffnung ohne Vorsorge endet im Kontrollverlust.
Das Sprichwort lehrt: Vertraue auf Gott – aber binde dein Kamel fest.
Für Unternehmer bedeutet das: Vertraue auf deine Vision – aber sichere sie mit Zahlen, Systemen und Menschen, die dir widersprechen dürfen.
Denn Optimismus ist ein Motor. Aber ohne Vorsorge läuft er ins Leere.
Und am Ende gilt: Dein Kamel bleibt nur deins, wenn du es auch festbindest.