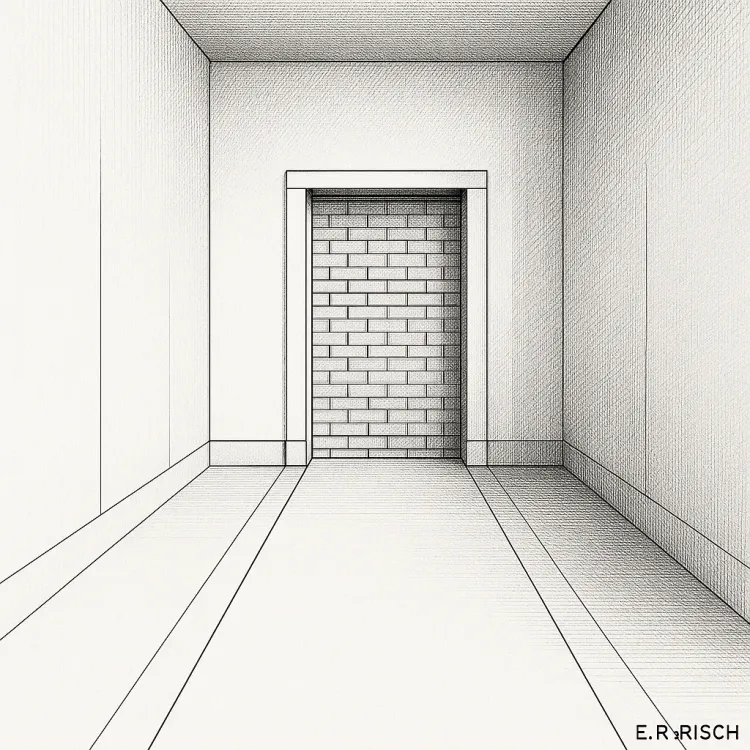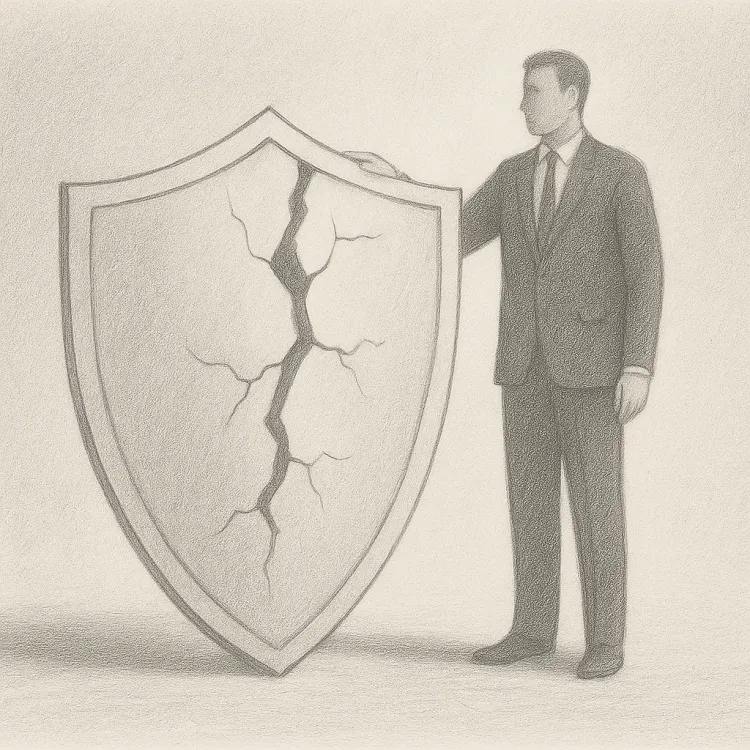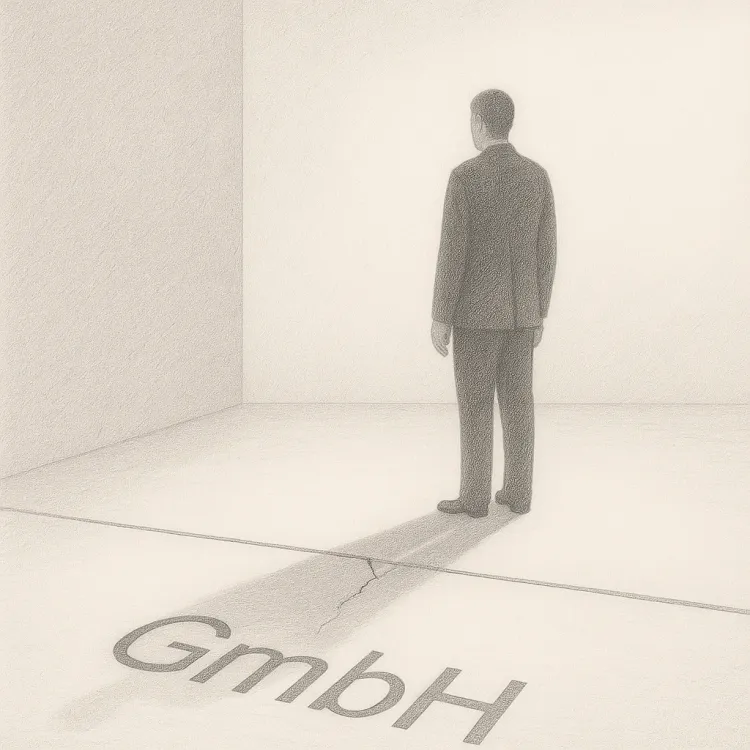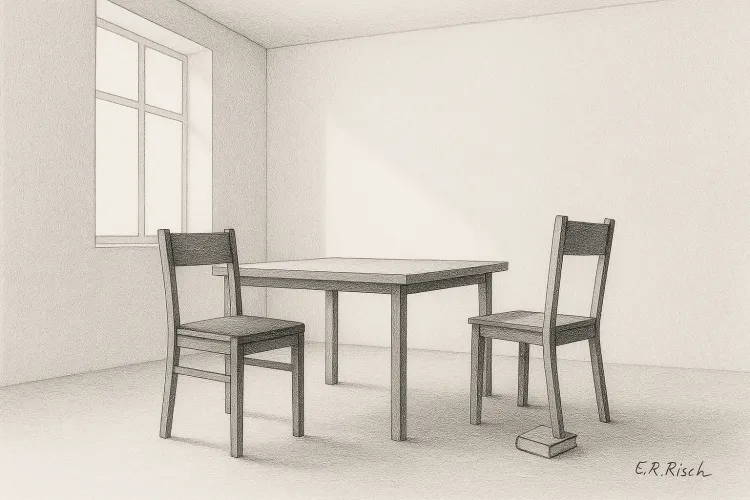Pflichten eines GmbH-Geschäftsführers: Was das Gesetz verlangt – und was in der Krise wirklich zählt
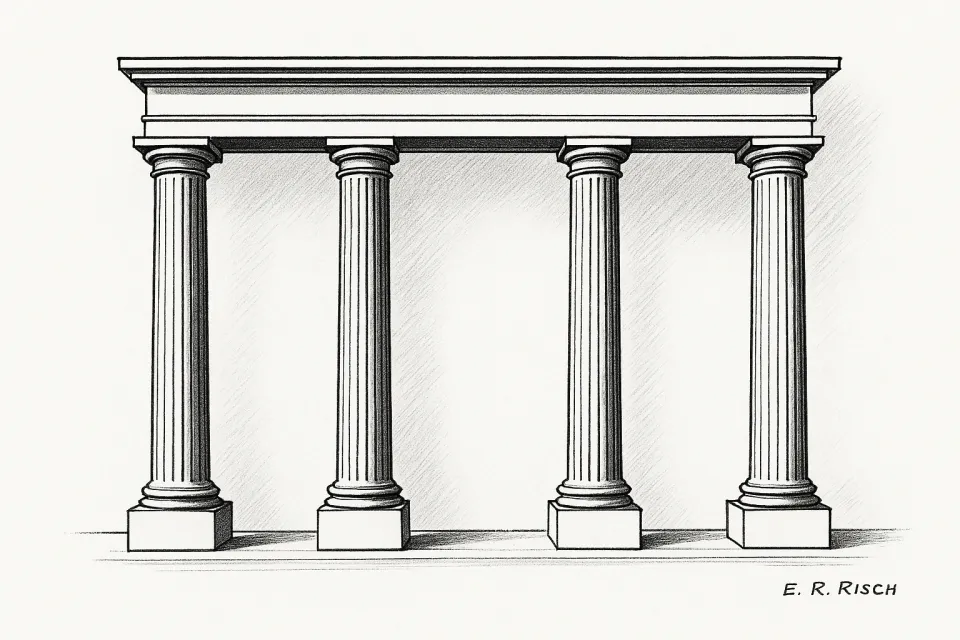
Warum darf eigentlich jeder GmbH-Geschäftsführer werden – ohne „Führerschein“, ohne Grundkurs, ohne echte Vorbereitung?
Viele stolpern ins Amt, ohne wirklich zu wissen, was auf sie zukommt.
Und das betrifft nicht nur Quereinsteiger: Selbst studierte Betriebswirte berichten oft, dass sie in ihrem Studium kaum auf die konkreten Pflichten und Haftungsrisiken vorbereitet wurden. Controlling, Strategie, Finanzen – ja. Aber die Details zur Kapitalerhaltung, zur Insolvenzantragspflicht oder zu § 1 StaRUG? Fehlanzeige.
Das Ergebnis zeigt sich in den Insolvenzstatistiken:
Laut einer Analyse von Euler Hermes nannten Insolvenzverwalter als Hauptursache für Unternehmensinsolvenzen Managementfehler – fehlendes Controlling (79 %), Finanzierungslücken (76 %) und mangelnde Kommunikation (44 %).
Mit anderen Worten: Nicht immer der Markt, nicht immer die Banken – sondern die Geschäftsführung selbst bringt die Firma zu Fall.
Und genau deshalb lohnt es sich, die rechtlichen Pflichten nicht als Fußnoten zu betrachten, sondern als Kernaufgabe. Im Folgenden die zentralen Pflichten – klar nach Pflichtkern, Praxisbeispiel und Rechtsprechung gegliedert.
1. Sorgfaltspflicht (§ 43 GmbHG)
Die Sorgfaltspflicht ist das Dach über allem. Sie konkretisiert, wie ein Geschäftsführer seine Rolle ausfüllen muss: mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns.
1.1 Entscheidungsfindung – Business Judgment Rule
Pflichtkern: Entscheidungen sind nur geschützt, wenn sie auf einer angemessenen Informationsbasis getroffen werden, frei von Sonderinteressen und im Interesse der Gesellschaft.
Praxisbeispiel: Ein Geschäftsführer entscheidet, einen Auftrag mit minimaler Marge anzunehmen. Dokumentiert er Chancen und Risiken sauber, ist er geschützt – selbst wenn der Auftrag später Verluste bringt.
Rechtsprechung: BGH, Urt. v. 21.04.1997 – II ZR 175/95: Die Business Judgment Rule schützt nur, wenn die Entscheidung sorgfältig vorbereitet und dokumentiert wurde.
1.2 Organisation & Überwachung
Pflichtkern: Der Geschäftsführer muss die Gesellschaft so organisieren, dass Risiken frühzeitig erkannt werden können.
Praxisbeispiel: Es existiert kein Frühwarnsystem für Liquidität. Erst Mahnungen der Lieferanten zeigen, dass die Kasse leer ist.
Rechtsprechung: BGH, Urt. v. 20.02.1995 – II ZR 9/94: Pflicht zur Einrichtung eines Überwachungssystems; wer passiv bleibt, verletzt seine Organisationspflicht.
1.3 Informations- und Berichtspflichten
Pflichtkern: Geschäftsführer müssen Gesellschafter rechtzeitig und vollständig informieren – auch über schlechte Nachrichten.
Praxisbeispiel: Ein GF verschweigt drohende Covenant-Verletzungen gegenüber dem Beirat; die Bank zieht Kreditlinien ein.
Rechtsprechung: OLG München, Urt. v. 25.11.2010 – 23 U 4795/10: Verspätete Information des Aufsichtsgremiums stellt eine Pflichtverletzung dar.
1.4 Delegation & Beratersteuerung
Pflichtkern: Aufgaben dürfen delegiert werden, Verantwortung nicht. Auch bei externen Beratern bleibt die Kontrollpflicht.
Praxisbeispiel: Der Steuerberater erstellt eine fehlerhafte Liquiditätsplanung – der Geschäftsführer übernimmt sie ungeprüft.
Rechtsprechung: BGH, Urt. v. 14.07.2008 – II ZR 202/07: Unkritisches Vertrauen auf Berater entlastet nicht von der Haftung.
2. Kapitalerhaltung in der GmbH – mehr als nur ein Paragraf
Das Stammkapital der GmbH ist nicht einfach „Startgeld“. Es ist die rechtlich geschützte Basis der Gesellschaft – und seine Erhaltung ist streng geregelt.
Pflichtkern: § 30 GmbHG
„Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden.“
Das bedeutet:
- Das Haftungskapital muss dauerhaft erhalten bleiben.
- Verboten sind nicht nur offene Ausschüttungen, sondern auch verdeckte Entnahmen – z. B. überhöhte Gehälter, ungesicherte Darlehen, private Aufwendungen über die Gesellschaft.
Rückgewähr- und Ersatzpflichten (§§ 31, 32 GmbHG)
Kommt es doch zu einer verbotenen Auszahlung, muss der Empfänger sie zurückzahlen (§ 31 GmbHG). Auch Dritte können in Anspruch genommen werden, wenn sie erkennbar gegen das Kapitalerhaltungsgebot verstoßende Leistungen erhalten (§ 32 GmbHG).
Persönliche Haftung (§ 43 GmbHG)
Beispiel: Wird ein Gesellschafterdarlehen zurückgeführt, das wirtschaftlich wertlos ist, haftet der Geschäftsführer neben dem Gesellschafter selbst – auch mit seinem Privatvermögen.
Frühwarnsystem nach innen: § 49 Abs. 3 GmbHG
Wird aus der Bilanz erkennbar, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist, müssen Geschäftsführer unverzüglich eine Gesellschafterversammlung einberufen. Unterlassen sie dies, drohen persönliche Haftung und ggf. der Vorwurf der Insolvenzverschleppung.
Unterbilanz und Insolvenznähe
Wenn das Stammkapital bilanziell aufgebraucht ist und keine Aktiva mehr dagegenstehen, liegt regelmäßig Überschuldung (§ 19 InsO) vor. Dann: Pflicht zur Fortführungsprognose – und ggf. Insolvenzantrag nach § 15a InsO.
Rechtsprechung
- BGH, Urt. v. 16.01.2006 – II ZR 300/05: Geschäftsführer haften persönlich für verbotene Auszahlungen bei Unterbilanz.
- BGH, Urt. v. 21.03.2013 – IX ZR 64/12: In der Krise sind alle Leistungen an Gesellschafter streng zu prüfen.
3. Insolvenzantragspflicht (§ 15a InsO)
Pflichtkern: Bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ist ohne schuldhaftes Zögern, spätestens innerhalb von drei Wochen, Insolvenzantrag zu stellen.
Praxisbeispiel: Eine GmbH ist faktisch zahlungsunfähig, hofft aber auf einen Investor. Die Geschäftsführung wartet die drei Wochen aus – ohne verbindliche Zusage. Ergebnis: verspäteter Antrag, persönliche Haftung, strafrechtliche Konsequenzen.
Rechtsprechung: BGH, Urt. v. 28.02.2023 – II ZR 162/21: Die Drei-Wochen-Frist ist das äußerste Limit – keine Schonfrist.
4. Zahlungsverbot (§ 64 GmbHG / § 15b InsO)
Pflichtkern: Nach Eintritt der Insolvenzreife dürfen grundsätzlich keine Zahlungen mehr geleistet werden – außer sie sichern kurzfristig den Betrieb.
Praxisbeispiel: Der Geschäftsführer zahlt nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit noch Lieferantenrechnungen, um den Betrieb „irgendwie am Laufen“ zu halten. Später nimmt der Insolvenzverwalter ihn persönlich in Anspruch.
Rechtsprechung: BGH, Urt. v. 04.07.2017 – II ZR 319/15: Geschäftsführer haften für jede einzelne Zahlung nach Eintritt der Insolvenzreife.
5. Krisenfrüherkennung (§ 1 StaRUG)
Pflichtkern: Seit 2021 müssen Geschäftsleiter ein Krisenfrüherkennungssystem einrichten, um drohende Zahlungsunfähigkeit rechtzeitig zu erkennen.
Praxisbeispiel: Die GmbH hat Monatsabschlüsse, aber keine Liquiditätsvorschau. Erst als die Bank Kreditlinien kürzt, erkennt die Geschäftsführung den Ernst der Lage.
Rechtsprechung: Erste Urteile deuten an: fehlende Systeme können als Pflichtverletzung gewertet werden. Banken prüfen heute aktiv, ob solche Systeme existieren.
6. Praxis-Checkliste für Geschäftsführer
- Liquidität: Wöchentliche 13-Wochen-Planung + rollierende Jahresplanung.
- Dokumentation: Entscheidungen schriftlich festhalten.
- Kapital: Keine Auszahlungen an Gesellschafter ohne Prüfung nach § 30 GmbHG.
- Antragspflicht: Zahlungsfähigkeit laufend überwachen – täglich in der Krise.
- Kommunikation: Transparenz mit Gesellschaftern, Banken, Beirat.
- Frühwarnsystem: Kennzahlen, Szenario-Analysen, klare Verantwortlichkeiten.
Fazit: Vier Säulen, ein Maßstab
Die Pflichten eines GmbH-Geschäftsführers sind kein juristisches Beiwerk – sie sind das Rückgrat verantwortungsvoller Unternehmensführung.
- Sorgfaltspflicht: Entscheidungen treffen, Organisation sichern, informieren, delegieren mit Kontrolle.
- Kapitalerhaltung: Stammkapital ist Gläubigerschutz, kein Spielgeld.
- Insolvenzantragspflicht: Drei Wochen sind die harte Grenze – oft ist früher Pflicht.
- Zahlungsverbot & Früherkennung: Keine riskanten Zahlungen, aber proaktive Systeme.
Wer diese Leitplanken beachtet, schützt nicht nur die Gesellschaft, sondern auch sich selbst.
Denn eines ist sicher: Nicht wissen schützt nicht – handeln schon.