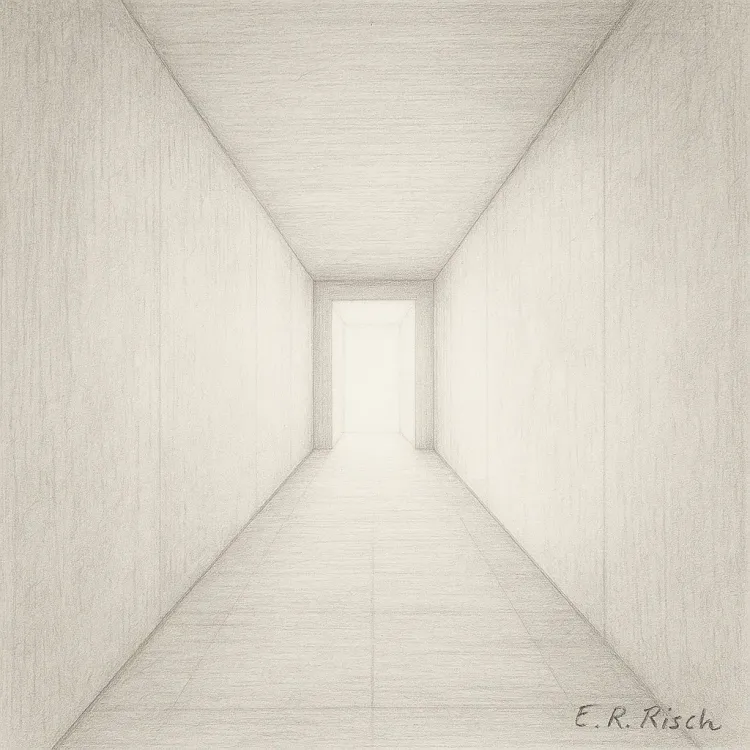Restrukturierungsfahrplan: Von der Liquiditätssicherung bis zur Neuaufstellung
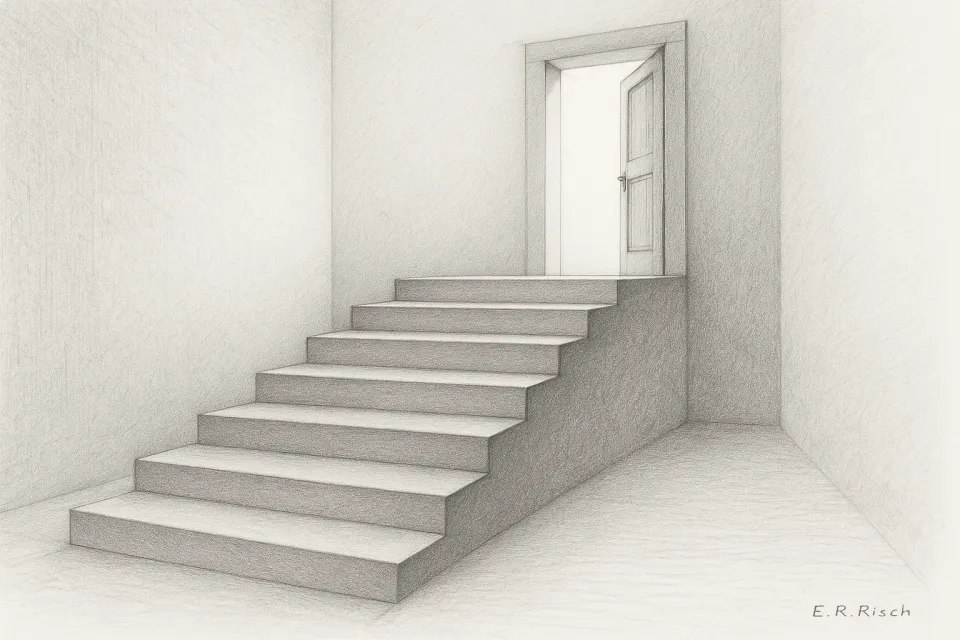
Es beginnt selten mit einem Knall.
Oft ist es ein Gefühl. Ein CFO, der nachts auf die Konten schaut und spürt, dass die Luft dünn wird.
Ein Eigentümer, der zum ersten Mal fragt, wie lange das Geld noch reicht.
Ein Lieferant, der plötzlich Vorkasse will.
Die Krise hat begonnen – nur noch niemand hat sie ausgesprochen.
Restrukturierung ist kein Reflex.
Sie ist ein Fahrplan.
Und wer ihn kennt, führt. Wer ihn nicht kennt, wird geführt.
1. Liquidität sichern – Handlungsfähigkeit bewahren
Wenn der Puls steigt, hilft kein Konzept, sondern nur eines: Kassensturz.
Liquidität ist der Sauerstoff der Sanierung.
Ohne sie kein Denken, kein Verhandeln, kein Vertrauen.
Deshalb beginnt jeder ernsthafte Prozess mit der 13-Wochen-Liquiditätsplanung – nüchtern, detailliert, brutal ehrlich.
Nicht als Excel-Übung, sondern als Überlebenskarte:
Welche Zahlungen sind existenziell? Welche nur Gewohnheit?
§ 17 InsO nennt es „Zahlungsunfähigkeit“.
Juristisch nüchtern – praktisch lebensbedrohlich.
Eine Unterdeckung von mehr als zehn Prozent über drei Wochen gilt als insolvenzreif (BGH, ZIP 2005, 1230).
Wer dann weiterzahlt, verletzt § 15b InsO – und riskiert persönliche Haftung.
Aber jenseits des Rechts geht es um etwas anderes:
Transparenz.
Denn wer seine Zahlungsfähigkeit dokumentiert, gewinnt nicht nur Zeit, sondern Glaubwürdigkeit.
Eine gute Liquiditätsplanung ist kein Formular. Sie ist das erste Signal: Wir haben verstanden.
2. Ursachen verstehen – von Symptomen zu Strukturen
Krisen sind selten plötzlich.
Sie wachsen – leise, schleichend, bequem.
Man sieht es an der Marge, an Projekten, die „später“ abgeschlossen werden sollen, an Forecasts, die niemand mehr glaubt.
Die Krise steht längst in den Zahlen – nur liest sie keiner.
IDW S6 Tz. 25–29 unterscheidet drei Stufen:
strategische Krise – Ergebniskrise – Liquiditätskrise.
Wer erst in der dritten reagiert, hat die ersten zwei verschlafen.
Diese Phase verlangt Klarheit, nicht Schuldige.
Welche Geschäftsbereiche tragen noch?
Welche Kunden binden Kapital statt Wert zu schaffen?
Welche Struktur passt nicht mehr zur Marktlogik?
Juristisch betrachtet ist die Ursachenanalyse die Grundlage der Fortführungsprognose (§ 19 Abs. 2 InsO).
Psychologisch ist sie der Moment, in dem sich die Führung neu sortieren muss:
Nicht, was war, zählt – sondern, was tragfähig bleibt.
Die ehrlichste Frage dieser Phase lautet:
„Was würden wir tun, wenn wir heute neu starten müssten?“
Alles andere ist Verteidigung.
3. Vertrauen stabilisieren – Stakeholder synchronisieren
In der Krise sind Fakten wichtig – aber Vertrauen entscheidet.
Banken verhandeln keine Zahlen, sie verhandeln Belege.
Mitarbeiter folgen keiner Strategie, sie folgen Klarheit.
Und Gesellschafter streiten nicht über Maßnahmen, sondern über Kontrolle.
§ 43 GmbHG verpflichtet zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung,
§ 1 StaRUG zur Krisenfrüherkennung.
Beides hat denselben Kern: Kommunikation.
Doch Kommunikation ist kein Pressetext.
Sie ist Führung durch Unsicherheit.
In dieser Phase müssen alle denselben Satz hören – aber nicht dieselbe Geschichte.
Die Bank braucht Fakten, der Beirat Sicherheit, die Belegschaft Orientierung.
Wer allen dieselbe PowerPoint schickt, hat schon verloren.
Vertrauen entsteht nicht durch Worte, sondern durch Verhalten.
Der BGH hat es trocken formuliert: Frühzeitige, konsistente Information reduziert Haftungsrisiken (BGH ZIP 2007, 1031).
In Wahrheit heißt das: Wer spricht, bevor er gefragt wird, bleibt gestaltend.
Wer schweigt, verliert.
4. Sanierungsfähigkeit prüfen – der IDW S6 als Prüfrahmen
Ab einem Punkt reicht Intuition nicht mehr.
Dann braucht die Sanierung ein Fundament – ein Konzept, das Bank, Eigentümer und Geschäftsführung gleichermaßen trägt.
Das IDW S6-Gutachten ist dafür der Standard.
Nicht, weil es Formalismus liebt, sondern weil es Klarheit erzwingt.
Es beantwortet vier Fragen:
- Woher kommen die Probleme?
- Wie lassen sie sich beheben?
- Wie sieht das Zielbild aus?
- Ist die Fortführung überwiegend wahrscheinlich (§ 19 Abs. 2 InsO)?
Die integrierte Planung – GuV, Bilanz, Cashflow – ist dabei keine Pflichtübung, sondern der Lackmustest für Glaubwürdigkeit.
Denn eine Planung, die im Cash nicht stimmt, ist keine.
Gerichte und Banken haben das längst verstanden:
Das IDW S6 gilt heute als Beurteilungsmaßstab (u. a. OLG München, 25. 02. 2021 – 23 U 3848/20).
Aber jenseits der Paragraphen zählt etwas anderes:
Ein Konzept ist nur dann etwas wert, wenn es führbar ist.
Kein Sanierer der Welt kann ein Unternehmen retten, dessen Management das eigene Konzept nicht versteht.
5. Das richtige Instrument wählen – außergerichtlich, StaRUG oder InsO
Ab hier entscheidet das Timing – und das Recht.
|
Stadium |
Instrument |
Rechtsgrundlage |
|
noch zahlungsfähig, aber Druck spürbar |
außergerichtliche Sanierung |
Vertragsfreiheit |
|
drohende Zahlungsunfähigkeit |
StaRUG-Verfahren |
§ 18 InsO, § 29 StaRUG |
|
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung |
Insolvenz / Eigenverwaltung |
§§ 17–19 InsO |
Die Wahl ist nicht frei – sie folgt dem Gesetz.
Wer zu spät handelt, verliert.
Denn mit Eintritt der Zahlungsunfähigkeit greift § 15a InsO: Antragspflicht.
Dann entscheidet das Gericht, nicht mehr das Management.
Das StaRUG kann die Brücke sein – wenn man früh genug handelt.
Es ermöglicht die gerichtliche Bestätigung eines Restrukturierungsplans, bevor die Insolvenz droht.
Aber es verlangt: Dokumentation, Planung, Mut.
Die außergerichtliche Sanierung bleibt der Königsweg – diskret, schnell, aber fragil.
Sie lebt von Vertrauen, nicht von Zwang.
Und sie scheitert, wenn nur einer am Tisch glaubt, er könne im Verfahren besser wegkommen.
Die Insolvenz schließlich ist nicht das Ende, sondern das härteste Werkzeug.
Sie kann heilen – aber nur, wenn sie geführt wird.
Ohne Konzept wird sie zur Zerschlagung. Mit Konzept kann sie Neuanfang sein.
6. Neuaufstellung – Strategie, Governance, Kultur
Sanierung ist kein Ziel, sondern ein Übergang.
Wer sie als Abschluss versteht, verliert sie sofort wieder.
Nach der Stabilisierung folgt die Arbeit, die keine Excel kennt:
- Strategie: Wie verdient das Unternehmen künftig Geld – und womit nicht mehr?
- Governance: Wer trifft Entscheidungen, wer kontrolliert, wer spricht wann mit wem?
- Kultur: Wie gehen Menschen künftig mit Unsicherheit um?
§ 1 StaRUG und § 43 GmbHG machen klar: Krisenfrüherkennung und ordnungsgemäße Führung sind Dauerpflichten, keine Sanierungsaufgaben.
Führung in dieser Phase bedeutet, Verantwortung neu zu denken:
Nicht alle Risiken vermeiden, sondern sie sichtbar machen und steuern.
Nicht alles wissen, sondern das Wichtige entscheiden.
Kultur wird hier zur Strategie.
Denn Vertrauen ersetzt kein Kapital – aber es beschleunigt jedes.
Fazit – Sanierung ist Führung
Am Ende ist Restrukturierung keine Excel-Übung und kein juristisches Verfahren.
Sie ist ein Führungsakt – unter rechtlichen Leitplanken.
Wer Liquidität sichert, Ursachen versteht, Vertrauen aufbaut und das richtige Instrument wählt, führt nicht nur durch die Krise.
Er formt das Unternehmen neu – finanziell, strukturell, menschlich.
Krise ist kein Zustand.
Sie ist eine Haltung.
Und Führung bedeutet, diese Haltung zuerst bei sich selbst zu entwickeln – bevor man sie von anderen erwartet.