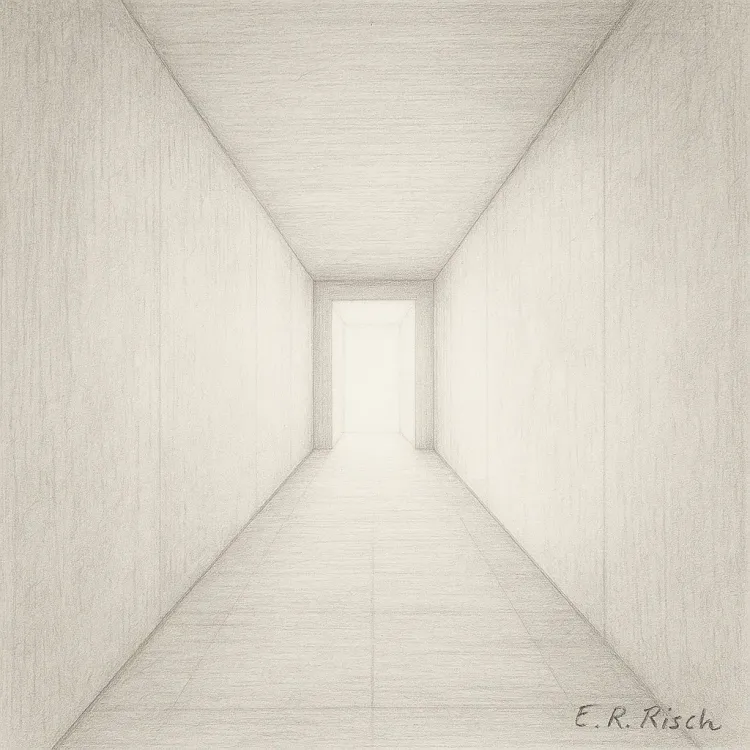Restrukturierungsinstrumente im Vergleich: StaRUG, InsO, außergerichtliche Lösungen
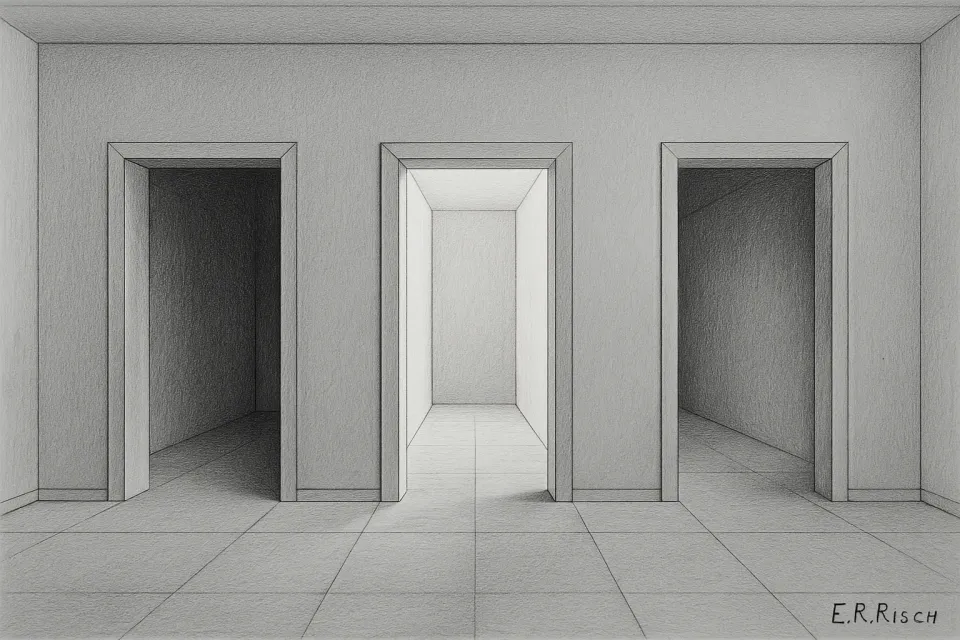
Die Wahl ist strategisch – aber nicht frei
Viele Geschäftsführer glauben, sie hätten in der Krise alle Optionen auf dem Tisch. Die Realität ist härter: Das Gesetz gibt den Takt vor. Wer bereits zahlungsunfähig ist, darf nicht mehr verhandeln, sondern muss den Insolvenzantrag stellen. Wer drohende Zahlungsunfähigkeit rechtzeitig erkennt, kann auf das StaRUG zurückgreifen. Und nur wer sehr früh agiert, hat überhaupt die Chance auf eine außergerichtliche Lösung.
Damit wird klar: Die Wahl des Instruments ist eine strategische Entscheidung, aber sie ist rechtlich klar begrenzt. Wer zu spät reagiert, verliert seine Optionen. Und wer glaubt, er könne sich mit einem Trick um Pflichten herummogeln, riskiert nicht nur das Unternehmen, sondern auch persönliche Haftung.
Außergerichtlich: der Königsweg mit dem Unsicherheitsfaktor
Wenn es gelingt, Gläubiger an einen Tisch zu bringen und auf einen gemeinsamen Plan einzuschwören, ist die außergerichtliche Sanierung das eleganteste Mittel. Keine Öffentlichkeit, keine Gerichtskosten, kein Stigma. Aber eben auch keine Garantie.
Der Schlüssel liegt im Sanierungsplan. Ohne belastbares Konzept sind Banken und Lieferanten nicht bereit, auf Rechte zu verzichten oder Stundungen zu gewähren. Ein Plan muss zeigen, wie die Liquidität kurzfristig gesichert wird, welche Maßnahmen die Erträge stabilisieren und welche Beiträge Gläubiger oder Gesellschafter leisten. Alles andere wirkt wie ein Bettelbrief – und scheitert in der Regel.
Die Praxis zeigt: Banken haben unterschiedliche Erwartungshaltungen. Eine Hausbank mit langfristiger Beziehung ist oft kompromissbereiter, solange der Plan stichhaltig ist. Lieferanten dagegen reagieren nervöser: Sie fürchten, Waren zu liefern und später nur einen Bruchteil bezahlt zu bekommen. Leasinggesellschaften wiederum pochen auf ihre Verträge – sie können Maschinen oder Fahrzeuge zurückholen und haben damit faktisch eine stärkere Verhandlungsposition als Banken.
Typische Fallen: Viele Geschäftsführer überschätzen den Wert von „Absichtserklärungen“. Ein Plan, der nur in PowerPoint existiert und keine durchgerechnete Liquiditätsplanung enthält, schafft kein Vertrauen. Auch die Rolle einzelner Gläubiger wird oft unterschätzt. Es reicht ein einziger Blockierer, um den ganzen Weg zu torpedieren.
Ein Fall aus der Industrie zeigt das Dilemma: Ein Zulieferer verhandelte erfolgreich mit zwei Großbanken über eine Laufzeitverlängerung der Kredite. Doch ein einzelner Leasinggeber lehnte ab – und damit war das gesamte Konzept wertlos. Rechtlich betrachtet ist genau das der Schwachpunkt: Ohne Einstimmigkeit bleibt der außergerichtliche Weg blockiert. Und sobald § 17 InsO greift – also Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist – darf die Geschäftsführung gar nicht mehr auf Freiwilligkeit setzen, sondern muss nach § 15a InsO den Insolvenzantrag stellen.
Zwischenfazit: Der außergerichtliche Weg ist der Königsweg – aber nur so stark wie der Plan, der ihn trägt. Wer hier scheitert, scheitert selten an Zahlen, sondern an Psychologie und Verhandlungsmacht.
StaRUG: die Brücke in der Vorinsolvenz
Seit 2021 gibt es mit dem StaRUG ein Werkzeug für Unternehmen, die noch nicht zahlungsunfähig sind, bei denen es aber in den nächsten Monaten eng werden könnte. Juristisch spricht man von „drohender Zahlungsunfähigkeit“. Praktisch heißt das: Der Kassenstand reicht vielleicht heute, aber die Prognose zeigt Lücken.
Der Vorteil des StaRUG liegt darin, dass nicht mehr jeder Gläubiger zustimmen muss. Wenn die Mehrheit einverstanden ist, können Minderheiten überstimmt werden – das Gericht bestätigt den Restrukturierungsplan. Gerade Banken schätzen diesen Rahmen, weil er rechtliche Sicherheit bietet.
Doch das StaRUG ist kein Allheilmittel. Arbeitnehmerforderungen sind ausgeschlossen, und die formalen Anforderungen sind hoch. Vor allem verlangt das Gesetz, dass die Geschäftsführung ein funktionierendes Krisenfrüherkennungssystem etabliert hat (§ 1 StaRUG). Wer die Signale verschläft, kann das StaRUG nicht nutzen.
Rechtlicher Drehpunkt: „Drohende Zahlungsunfähigkeit“ (§ 18 InsO) bedeutet: Das Unternehmen wird voraussichtlich in den kommenden 24 Monaten nicht mehr in der Lage sein, seine Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen. Damit liegt das StaRUG im Zwischenraum: zu früh für die Insolvenz, zu spät für kosmetische Gespräche.
Praxisfehler: Viele Unternehmen scheitern an der Dokumentation. Wer keine integrierte Finanzplanung hat, kann den Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit nicht belegen – und verliert damit den Zugang zum StaRUG. Erste OLG-Beschlüsse haben klargestellt, dass pauschale Hinweise wie „wir sehen Liquiditätsprobleme“ nicht genügen.
Fallbeispiel: Ein Bauunternehmen stand 2023 kurz vor der Krise. Zwei Banken blockierten die außergerichtliche Lösung, obwohl die Mehrheit der Gläubiger hinter dem Plan stand. Über das StaRUG konnte ein gerichtlicher Restrukturierungsplan aufgestellt werden, der die Minderheit überstimmte. Ohne diese Möglichkeit hätte die Insolvenz gedroht.
Marktsicht: Der Fall Adler Group zeigte 2022, wie sensibel Märkte reagieren. Bereits Gerüchte über ein mögliches StaRUG-Verfahren ließen Anleihen einbrechen. StaRUG ist also kein „geheimer Rettungsanker“ – sondern ein Signal, das sofort von Investoren gedeutet wird.
Zwischenfazit: StaRUG ist die Brücke für gut vorbereitete Unternehmen, die früh handeln. Aber es ist nichts für Taktierer – wer zu spät kommt oder unsauber dokumentiert, findet die Brücke hochgezogen.
Insolvenz: das Verfahren der letzten Stunde
Wenn nichts mehr geht, greift die Insolvenzordnung. Das klingt nach Abwicklung – ist es aber nicht zwingend. Über Schutzschirmverfahren und Eigenverwaltung haben Geschäftsführer die Möglichkeit, selbst im Verfahren noch eine aktive Rolle zu spielen. Entscheidend ist allerdings, ob Gericht und Gläubiger Vertrauen in die Sanierungsfähigkeit haben.
Das Schutzschirmverfahren (§ 270b InsO) ist eine Art „Insolvenz light“. Es erlaubt der Geschäftsführung, unter Aufsicht eines Sachwalters am Ruder zu bleiben – vorausgesetzt, es liegt noch keine Zahlungsunfähigkeit vor. Die Eigenverwaltung (§ 270a InsO) geht in eine ähnliche Richtung, allerdings mit stärkerer Kontrolle. Erst die reguläre Insolvenz überträgt die Kontrolle vollständig auf den Insolvenzverwalter.
Aus Bankensicht ist die Eigenverwaltung ein zweischneidiges Schwert. Viele Kreditinstitute misstrauen Geschäftsführern, die „ihre eigene Sanierung überwachen“. Oft fordern sie, dass ein CRO oder ein externer Generalbevollmächtigter das Verfahren begleitet. Fehlt dieses Vertrauen, wird die Eigenverwaltung schnell abgelehnt.
Fallbeispiel Galeria Karstadt Kaufhof: Das Unternehmen konnte durch ein Insolvenzplanverfahren saniert werden – allerdings zu einem hohen Preis. Mehrere Sanierungsrunden, Hunderte Filialschließungen, Tausende Arbeitsplätze verloren. Politisch wurde heftig debattiert, ob die Insolvenzordnung hier ein Sanierungsinstrument oder ein „Schrumpfungsprogramm“ ist. Juristisch betrachtet war der Gang ins Verfahren alternativlos: Zahlungsunfähigkeit zwingt nach § 15a InsO zum Antrag.
Andere Beispiele zeigen das Spektrum: Air Berlin scheiterte 2017 trotz intensiver Gespräche – das Insolvenzverfahren endete in einer Zerschlagung. Schlecker versuchte 2012 eine Eigenverwaltung, scheiterte aber am Vertrauen der Gläubiger und musste in die Regelinsolvenz. Beide Fälle zeigen: Ohne Gläubigervertrauen und realistischen Plan nützt auch die Insolvenzordnung wenig.
Auch im Mittelstand gibt es erfolgreiche Szenarien. Ein Automobilzulieferer nutzte 2022 das Schutzschirmverfahren, um Darlehen und Mietverträge neu zu strukturieren. Erst durch die gerichtliche Rahmung ließen sich Banken überzeugen – außergerichtlich hätte niemand mehr zugestimmt.
Rechtliche Leitplanke: Mit Eintritt der Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) oder Überschuldung (§ 19 InsO) greift die Antragspflicht. Geschäftsführer haben keine Wahl mehr. Wer dann nicht unverzüglich handelt, macht sich persönlich haftbar – eine Konstante der BGH-Rechtsprechung.
Zwischenfazit: Die Insolvenz ist mächtig – aber brutal. Sie kann Unternehmen retten, doch um den Preis von Öffentlichkeit, Reputationsschaden und Kontrollverlust.
Drei Wege, drei Geschichten
Im Kern lassen sich die Instrumente so zusammenfassen:
- Außergerichtlich ist der Königsweg – wenn das Vertrauen noch reicht und alle mitziehen.
- StaRUG ist die Brücke – wenn Blockaden überwunden werden müssen, aber die Insolvenz noch nicht eingetreten ist.
- Insolvenz ist das Verfahren der letzten Stunde – mächtig, aber teuer und mit hohem Preis für Kontrolle und Ansehen.
Die Wahl hängt nicht nur von Zahlen ab, sondern auch von Psychologie. Ein außergerichtlicher Versuch kann scheitern, wenn ein einzelner Gläubiger glaubt, in der Insolvenz besser wegzukommen. Ein StaRUG-Plan kann blockiert werden, wenn die Geschäftsführung die Krise zu spät dokumentiert. Und eine Insolvenz kann die einzige Option sein, wenn das Management zu lange gezögert hat.
Wie es in der Praxis wirklich aussieht
Die Realität der außergerichtlichen Sanierung
In der Theorie klingt der außergerichtliche Weg so einfach: Ein Unternehmer ruft die wichtigsten Banken und Lieferanten zusammen, legt seinen Sanierungsplan auf den Tisch und bittet um Zugeständnisse. In der Realität läuft es selten so glatt. Banken wollen wöchentliche Liquiditätsreports sehen, prüfen die Plausibilität jedes Maßnahmenpakets und fordern Sicherheiten. Lieferanten fragen sich, ob sie noch liefern sollen, wenn in der Presse bereits von einer Krise die Rede ist. Und Leasinggesellschaften pochen gnadenlos auf ihre Verträge – schließlich können sie Maschinen oder Fahrzeuge einfach zurückholen.
Der Knackpunkt ist fast immer die Einstimmigkeit. Ein Plan mag noch so schlüssig sein – wenn auch nur ein einzelner Gläubiger blockiert, ist die Lösung gefährdet. Gerade kleinere Gläubiger mit überschaubarem Volumen nutzen ihre Position, um Sondervorteile herauszuschlagen. Für die Geschäftsführung bedeutet das: Sie muss nicht nur verhandeln, sondern auch Erwartungen moderieren, Machtspiele austarieren und politische Allianzen schmieden.
Juristisch gesehen bleibt das Zeitfenster eng. Solange keine Insolvenzantragspflicht besteht, ist der außergerichtliche Weg zulässig. Doch sobald Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO eingetreten ist, muss nach § 15a InsO der Antrag gestellt werden. Wer dann weiter auf Freiwilligkeit setzt, riskiert persönliche Haftung. In der Praxis bedeutet das: Der außergerichtliche Königsweg endet abrupt, wenn der Liquiditätsstatus kippt.
… wie oben beschrieben – mit Fokus auf Gläubigerpsychologie, Blockaden, Leasingfall – ergänzt durch die rechtliche Schwelle: Nur zulässig, solange keine Insolvenzantragspflicht (§ 15a InsO) besteht.
StaRUG im Praxistest
Das StaRUG ist wie ein Notausgang im Labyrinth: unscheinbar, aber entscheidend, wenn andere Wege blockiert sind. Es richtet sich an Unternehmen, die noch zahlungsfähig sind, aber deren Prognosen Lücken zeigen. Der juristische Schlüsselbegriff lautet „drohende Zahlungsunfähigkeit“. Übersetzt heißt das: In den kommenden zwei Jahren wird die Liquidität voraussichtlich nicht mehr reichen, um alle Verpflichtungen pünktlich zu bedienen.
In der Praxis ist genau diese Prognose das Problem. Viele Unternehmen haben keine integrierte Finanzplanung, die einen solchen Zeitraum belastbar abbilden könnte. Stattdessen werden grobe Excel-Tabellen vorgelegt, die Gerichte und Gläubiger kaum überzeugen. Erste OLG-Entscheidungen haben unmissverständlich klargemacht: Pauschale Hinweise auf „künftige Probleme“ genügen nicht. Wer StaRUG nutzen will, braucht harte Zahlen.
Ein Bauunternehmen machte 2023 vor, wie es funktionieren kann: Zwei Banken blockierten die außergerichtliche Sanierung, obwohl die Mehrheit der Gläubiger hinter dem Plan stand. Über das StaRUG konnte ein gerichtlicher Restrukturierungsplan aufgestellt werden, der die Minderheit überstimmte. Ohne diese Möglichkeit wäre die Insolvenz unausweichlich gewesen.
Gleichzeitig zeigt der Fall Adler Group, wie sensibel Märkte reagieren. Bereits Gerüchte über ein mögliches StaRUG-Verfahren ließen Anleihen einbrechen. StaRUG ist kein geheimer Rettungsanker – sondern ein Signal, das Investoren sofort deuten. Die Lehre: StaRUG ist mächtig, aber nur für die, die früh, sauber und transparent arbeiten.
Insolvenz als Sanierungsinstrument
Wenn der außergerichtliche Weg scheitert und das StaRUG zu spät kommt, bleibt nur noch die Insolvenzordnung. Sie klingt nach Abwicklung, ist aber längst auch ein Sanierungsinstrument. Über Schutzschirmverfahren und Eigenverwaltung haben Geschäftsführer die Möglichkeit, das Steuer zu behalten – solange das Gericht Vertrauen hat.
Prominente Beispiele zeigen das Spannungsfeld. Galeria Karstadt Kaufhof konnte über ein Insolvenzplanverfahren überleben – allerdings um den Preis von Filialschließungen und einem massiven Imageverlust. Air Berlin dagegen ging 2017 nach einem gescheiterten Sanierungsversuch in die Zerschlagung, Tausende Arbeitsplätze gingen verloren. Schlecker versuchte 2012 eine Eigenverwaltung, scheiterte jedoch am Vertrauen der Gläubiger – das Verfahren endete in einer Regelinsolvenz.
Im Mittelstand gibt es auch positive Geschichten. Ein Automobilzulieferer nutzte 2022 das Schutzschirmverfahren, um Darlehen und Mietverträge neu zu strukturieren. Die Banken akzeptierten den Plan nur, weil die gerichtliche Rahmung Sicherheit bot. Ohne Insolvenzverfahren hätte niemand mehr mitgespielt.
Rechtlich gibt es keinen Graubereich: Mit Eintritt der Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) oder Überschuldung (§ 19 InsO) greift die Antragspflicht (§ 15a InsO). Geschäftsführer haben dann keine Wahl mehr. Wer weiter wartet, macht sich haftbar – ständige Rechtsprechung des BGH. Die Insolvenz ist damit ein zweischneidiges Schwert: Sie eröffnet Sanierungschancen, aber unter Zwang und im Schaufenster.
Psychologie und Führung
Neben Recht und Zahlen ist die Psychologie oft der wahre Engpass. Viele Geschäftsführer hoffen, „noch ein Quartal durchzuhalten“ – aus Stolz, aus Angst vor Kontrollverlust oder in der Illusion, dass ein neuer Auftrag alles rettet. Aufsichtsräte wiederum fürchten die Signalwirkung einer Insolvenzmeldung und drängen auf Verzögerung. Gesellschafter hoffen auf den rettenden Investor, selbst wenn die Zahlen längst dagegensprechen.
In den Boardrooms wiederholt sich das gleiche Muster: Verdrängung, Machtspiele, falsche Loyalitäten. Der CRO oder Berater sitzt dann zwischen allen Stühlen – er soll Zahlen liefern, Lösungen präsentieren und gleichzeitig eine Kultur der Ehrlichkeit einfordern.
Die Wahrheit ist unbequem: Unternehmen scheitern in der Krise selten an Excel, sondern am Ego. Juristisch zwingt das Gesetz irgendwann zu klaren Entscheidungen. Doch bis dahin kosten die psychologischen Blockaden wertvolle Zeit. Wer in diesem Moment nicht die Führung übernimmt, verliert mehr als nur Optionen – er verliert das Vertrauen aller Beteiligten.
Was Geschäftsführer jetzt tun müssen
Entscheidend ist deshalb weniger die Frage „Welches Instrument passt zu uns?“, sondern: „Wo stehen wir wirklich?“ Wer die eigene Lage nicht ehrlich einschätzt, wird vom Gesetz eingeholt.
- Frühzeitig prüfen, ob drohende oder eingetretene Insolvenzreife vorliegt.
- Einen belastbaren Sanierungsplan erarbeiten – nicht für die Schublade, sondern für die Gläubiger.
- Optionen durchspielen: außergerichtlich, StaRUG, Insolvenz – und ehrlich bewerten, was realistisch ist.
- Gläubigerlandschaft analysieren: Wer könnte blockieren? Wer ist verhandlungsbereit?
- Externe Expertise einbinden: CRO, Restrukturierungsanwalt, Bankenberater.
Die Erfahrung zeigt: Wer rechtzeitig und professionell agiert, hat Gestaltungsspielräume. Wer zaudert, wird vom Gesetz in die Insolvenz gedrängt.
Fazit – Verantwortung kennt keine Ausrede
Restrukturierung ist kein juristisches Detailgeschäft. Sie ist eine Führungsaufgabe. Die Instrumente sind Werkzeuge, nicht mehr und nicht weniger.
Wer früh handelt, kann strategisch wählen. Wer spät reagiert, verliert Optionen. Und wer glaubt, das Gesetz lasse sich ignorieren, riskiert nicht nur das Unternehmen, sondern auch die eigene Karriere.
Am Ende entscheidet nicht das Instrument allein. Entscheidend ist die Fähigkeit des Managements, rechtzeitig die richtigen Weichen zu stellen – bevor andere übernehmen.