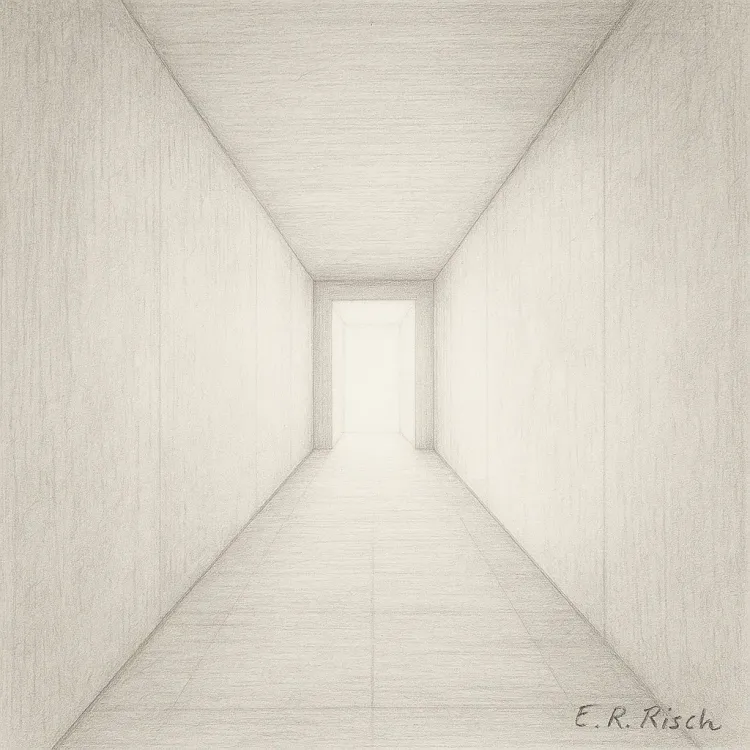Sanierungsabbruchschwelle: Wann ist der Punkt erreicht?
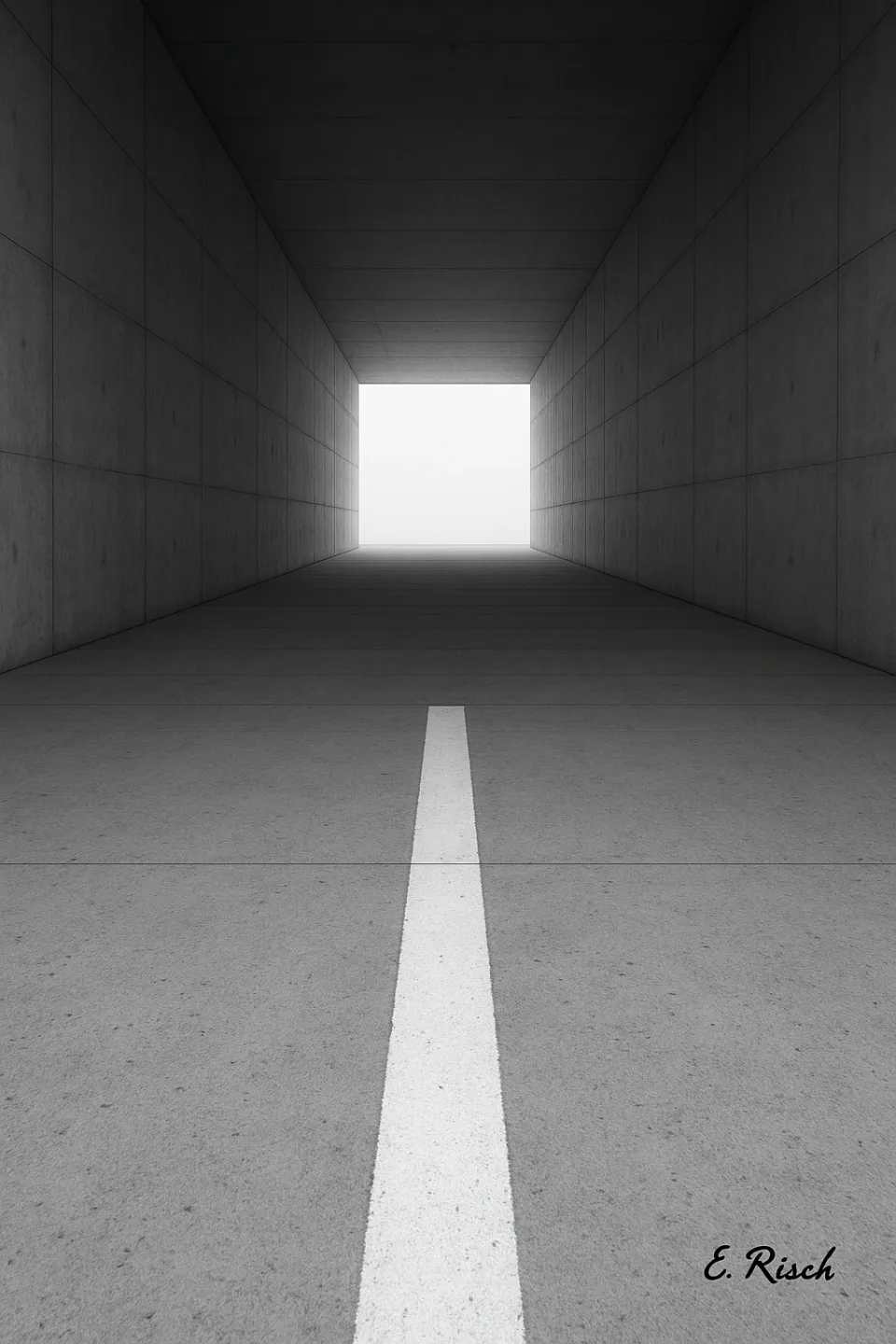
Es gibt in jeder Sanierung diesen Moment, der alles entscheidet.
Nicht, wenn das Konzept fertig ist.
Nicht, wenn die Bank grünes Licht gibt.
Sondern, wenn klar wird: So geht es nicht mehr weiter.
Zwischen Hoffnung und Pflicht verläuft eine unsichtbare Grenze – die Sanierungsabbruchschwelle.
Wer sie erkennt, kann Verantwortung übernehmen.
Wer sie ignoriert, riskiert Haftung, Vertrauen und in vielen Fällen seine eigene Existenz.
Der gefährlichste Moment jeder Sanierung
Sanierungen scheitern selten an fehlenden Ideen.
Sie scheitern an der Frage, wann man aufhört zu glauben – und anfängt zu entscheiden.
Viele Geschäftsführer klammern sich an Signale: eine laufende Investorensuche, ein unverbindlicher LOI, eine offene Bankzusage.
Doch rechtlich zählt nicht der Wille, sondern die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass eine Sanierung gelingt.
Genau hier liegt der Unterschied zwischen Führung und Hoffnung.
Was ist die Sanierungsabbruchschwelle?
Der Begriff ist kein Gesetzeswortlaut.
Aber er zieht sich wie ein roter Faden durch Sanierungsrecht, Bilanzrecht und Prüfungsstandards.
Die Sanierungsabbruchschwelle markiert den Zeitpunkt,
an dem die Fortführung eines Unternehmens nicht mehr vertretbar ist –
weder nach betriebswirtschaftlicher noch nach rechtlicher Betrachtung.
Sie ist das Ende der Fortführungsprognose (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).
Solange die Fortführungsprognose positiv ist, besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass die Sanierungsmaßnahmen greifen.
Sobald diese Wahrscheinlichkeit entfällt – weil Maßnahmen scheitern oder nicht ersetzt werden können –,
endet die positive Fortführungsprognose, und die Sanierungsabbruchschwelle ist erreicht.
Damit markiert sie den Übergang von einer noch vertretbaren Sanierungsfortführung zur Antragspflicht nach § 15a InsO
und steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Überschuldungsprüfung (§ 19 InsO).
Wie man erkennt, dass der Punkt erreicht ist
Eine Sanierung stirbt selten plötzlich.
Sie verliert an Glaubwürdigkeit – Stück für Stück, Woche für Woche.
Die Signale sind eindeutig, wenn man sie sehen will:
- Die Liquiditätsplanung zeigt negative Salden, selbst nach Maßnahmen.
- Die Finanzierungslücke lässt sich nicht mehr mit konkreten, belastbaren Zusagen schließen.
- Gläubiger und Banken verlieren Vertrauen, verlangen Vorkasse oder verweigern Stundungen.
- Geplante Maßnahmen werden zwar angepasst, aber nicht umgesetzt.
- Die Fortführungsprognose bleibt „bedingt positiv“ – seit Monaten.
Im IDW S6 heißt es dazu:
„Eine Fortführung gilt nur dann als überwiegend wahrscheinlich, wenn die zur Sanierung erforderlichen Maßnahmen hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Wirkung hinreichend sicher und dokumentiert sind.“
Mit anderen Worten: Glauben reicht nicht. Belege zählen.
Wenn überwiegend wahrscheinliche Maßnahmen scheitern
Die Sanierungsabbruchschwelle ist erreicht,
wenn die zuvor als überwiegend wahrscheinlich eingeschätzten Sanierungsmaßnahmen nicht eintreten
und nicht durch andere, gleichwertige Maßnahmen ersetzt werden können.
In diesem Moment kippt die Fortbestehensprognose ins Negative.
Das Unternehmen ist dann nicht mehr fortführungsfähig im Sinne des § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB und § 19 Abs. 2 InsO.
Juristisch bedeutet das:
Wenn die für die Fortführung erforderlichen Maßnahmen ihre überwiegende Eintrittswahrscheinlichkeit verlieren und keine neuen, gleichwertigen Maßnahmen erkennbar sind,
ist die Fortführungsannahme aufzugeben – und damit die Sanierungsabbruchschwelle erreicht.
Die Folge ist eindeutig:
Eine Fortführung ist dann nicht mehr vertretbar,
weil sie auf Annahmen beruht, deren Eintritt nicht mehr überwiegend wahrscheinlich ist.
Die Geschäftsführung muss prüfen, ob noch eine rechtfertigungsfähige Sanierungsfortführung besteht –
ist das nicht der Fall, endet die Sanierung – und beginnt die Antragspflicht (§ 15a InsO).
Der rechtliche Rahmen: Zwischen Hoffnung und Haftung
Spätestens mit Eintritt der Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) oder Überschuldung (§ 19 InsO) endet der Handlungsspielraum.
Dann gilt: drei Wochen – nicht mehr.
In dieser Zeit darf nur fortgeführt werden, wenn realistische Sanierungsaussichten bestehen und diese schriftlich dokumentiert sind.
Ein LOI oder eine mündliche Zusage reichen nicht.
Fehlt der Nachweis, greift die Insolvenzantragspflicht (§ 15a InsO).
Wer trotzdem weiterzahlt, verletzt das Zahlungsverbot (§ 15b InsO) und haftet persönlich – oft mit erheblichem Schaden.
Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung klargestellt:
„Das bloße Vertrauen auf zukünftige Liquidität ersetzt keine Fortführungsprognose.“
(BGH, Urt. v. 27.03.2012 – II ZR 171/10)
Damit ist der rechtliche Rahmen klar:
Hoffnung ist kein Sanierungskonzept.
Und Schweigen schützt nicht vor Haftung.
Ein Beispiel aus der Praxis
Ein mittelständischer Maschinenbauer, 150 Mitarbeitende.
Die Liquidität reicht für 14 Tage, ein Investor hat Interesse signalisiert.
Ein LOI liegt vor – unverbindlich, ohne Frist, ohne Kapitalnachweis.
Die Geschäftsführung wartet.
Zwei Wochen später ist der Investor abgesprungen, die Gehälter sind fällig, der Kontokorrent gekündigt.
Das Ergebnis: verspäteter Insolvenzantrag, persönliche Haftung, Rückforderungen gezahlter Gehälter.
Die Sanierung scheiterte nicht an den Zahlen – sondern am fehlenden Mut, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen.
Führung in der Krise: Die Kunst des rechtzeitigen Stopps
Viele Manager sehen den Sanierungsabbruch als Niederlage.
In Wahrheit ist er oft der letzte Akt verantwortungsvoller Führung.
Denn wer zu spät stoppt, übergibt nicht nur das Unternehmen an den Insolvenzverwalter –
sondern auch die eigene Deutungshoheit.
Der Abbruchpunkt ist kein Zeichen von Schwäche.
Er ist ein Akt der Governance.
Ein dokumentierter, begründeter Schritt, der zeigt:
Wir haben geprüft, bewertet und entschieden – auf Basis von Fakten, nicht von Hoffnung.
Wichtig ist die Dokumentation:
- Fortführungsprognose und Liquiditätsstatus,
- Beschlüsse des Managements,
- Kommunikation an Gesellschafter und Beirat.
Diese Unterlagen sind im Ernstfall die beste Verteidigung gegen den Vorwurf der Insolvenzverschleppung.
Fazit: Mut zur Klarheit
Die Sanierungsabbruchschwelle ist kein juristisches Konstrukt.
Sie ist ein Prüfstein für Führungsqualität.
Wer sie erkennt, beweist Haltung.
Wer sie ignoriert, verliert – erst Kontrolle, dann Vertrauen, am Ende die eigene Glaubwürdigkeit.
Denn jenseits dieser Schwelle endet Gestaltung – und beginnt Haftung.
Quellen und Bezüge
- § 15a, § 15b, § 17, § 19 InsO
- § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB (Fortführungsgrundsatz)
- IDW S6, Tz. 55 ff. – Fortführungsprognose
- IDW PS 270 n.F. – Prüfungsstandard zur Fortführungsannahme
- BGH, Urt. v. 27.03.2012 – II ZR 171/10