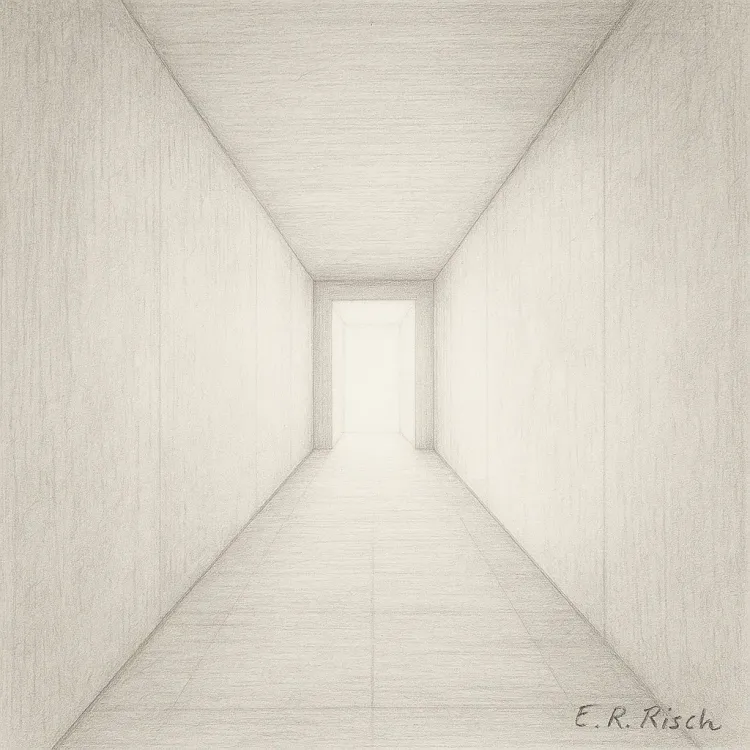Stillstand im Gesellschafterkreis
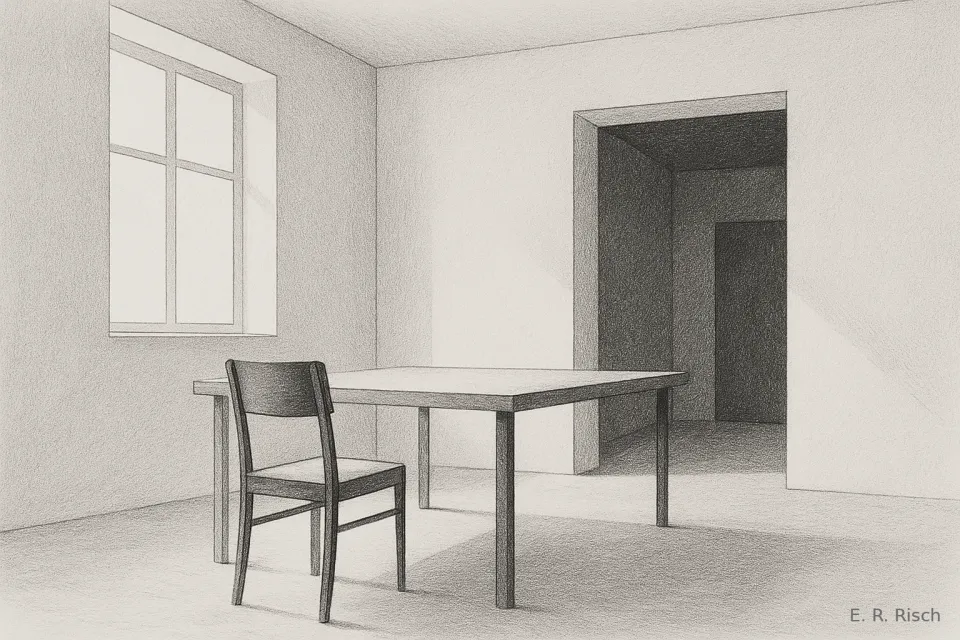
Warum Sanierung oft an den Eigentümern scheitert – und was man dagegen tun kann
Sanierung ist kein Sprint – aber ohne klare Richtung bleibt selbst der erste Schritt aus.
In der Praxis zeigt sich: Nicht selten scheitert eine wirtschaftlich notwendige Sanierung nicht am Markt, nicht an der Finanzierung, nicht einmal an der Geschäftsführung.
Sondern: am Gesellschafterkreis.
Das ist unbequem. Aber real.
Und es hat mit mehr zu tun als fehlendem Kapital oder Desinteresse.
Häufig sind es Governance-Probleme – und noch öfter psychologische Blockaden, die ein Unternehmen in der Krise handlungsunfähig machen.
1. Der blinde Fleck in der Sanierung: Der Gesellschafterkreis
In Sanierungsgutachten (IDW S6) wird der Gesellschafterstruktur meist ein kurzer Absatz gewidmet.
Dabei entscheidet genau dieser Aspekt oft darüber, ob Sanierung möglich ist – oder scheitert, bevor sie beginnt.
Typische Konstellationen:
- Mehrere Gesellschafter, aber keine klare Mehrheitsstruktur
- Mehrheitsgesellschafter, der operativ nicht eingebunden ist
- Familiengesellschaften mit schwelenden internen Konflikten
- Private-Equity-Fonds mit ablaufender Haltedauer
- Minderheitsgesellschafter mit Sperrminorität oder Sonderrechten
- Erbengemeinschaften ohne gemeinsame Linie
All das führt zu Blockaden bei zentralen Sanierungsentscheidungen:
Zustimmung zur Finanzierung, Veränderung der Geschäftsführung, Verzicht auf Ausschüttungen, Restrukturierung der Beteiligung.
2. Governance-Probleme: Wenn Regeln fehlen – oder nicht greifen
Fehlende Entscheidungsregeln
In vielen mittelständischen Unternehmen ist die Governance historisch gewachsen – aber nicht krisenfest.
Es gibt keine klare Geschäftsordnung, keine verbindlichen Entscheidungsmechanismen und keine Definition, wer im Krisenfall eigentlich das Sagen hat.
Folgen:
- Entscheidungen werden verzögert oder vertagt
- Niemand fühlt sich verantwortlich
- Selbst einfache Beschlüsse scheitern an der Einstimmigkeit
- Geschäftsführung bleibt handlungsunfähig
Sperrminoritäten und Sonderrechte
Gut gemeint – aber im Krisenfall fatal.
Wer 25,1 % hält, kann blockieren. Und das tun viele, wenn sie ihre Beteiligung „geschützt“ wissen wollen.
Auch Sonderrechte (Vetos, Zustimmungsvorbehalte, Geschäftsführerbestellungen) entfalten in der Krise oft eine toxische Wirkung.
Veraltete Gesellschaftsverträge
Viele Gesellschaftsverträge sind nicht für die Krise geschrieben.
Sie regeln Ausschüttungen, nicht Verlustdeckungen.
Sie kennen Eintrittsrechte, nicht Exit-Szenarien.
Und sie schreiben Mitspracherechte fest, wo Schnelligkeit und Flexibilität gefragt wären.
Was der Gesellschaftsrechtler sagt:
„In der Krise muss ein Gesellschaftsvertrag nicht nur Schutz bieten, sondern auch Flexibilität zulassen.
Viele Satzungen sind für den Normalbetrieb geschrieben – nicht für die Stunde null.
Ich empfehle Gesellschaftern, spätestens alle fünf Jahre eine Krisenprüfung der Governance vorzunehmen:
Gibt es ein Notfallgremium? Welche Beschlüsse sind zustimmungsbedürftig? Und wie können Minderheiten eingebunden werden, ohne Blockaden zu erzeugen?
Das Recht kennt dafür viele Instrumente: von Sanierungsklauseln über erleichterte Mehrheiten bis zu Stimmbindungsvereinbarungen. Man muss sie nur nutzen.“
3. Psychologische Blockaden: Wenn Emotionen wirtschaftliche Entscheidungen verhindern
Selbst mit sauberer Governance kann eine Sanierung scheitern – wenn die Eigentümer emotional blockieren.
Kognitive Dissonanz: „So schlimm ist es doch nicht.“
Viele Gesellschafter wollen die Krise nicht wahrhaben.
Sie klammern sich an vermeintlich positive Signale, spielen Risiken herunter oder zweifeln Gutachten an.
Typisch sind Aussagen wie:
- „Das war schon mal schlimmer.“
- „Wir brauchen nur mehr Vertrieb.“
- „Der Berater will nur seine Stunden abrechnen.“
Diese Form der kognitiven Dissonanz ist menschlich – aber gefährlich.
Denn sie verhindert klare Entscheidungen, solange noch Handlungsspielräume bestehen.
Verlustangst und Schuldabwehr
Sanierung bedeutet oft auch: Verzicht, Abwertung, Verantwortung übernehmen.
Viele Eigentümer haben Angst vor:
- Vermögensverlusten
- Reputationsschäden
- Haftungsrisiken
- interner Kritik („Du hast uns da reingeritten.“)
Stattdessen wird Schuld verschoben: auf die Geschäftsführung, den Markt, die Bank – oder auf andere Gesellschafter.
Das lähmt. Und verhindert lösungsorientiertes Denken.
Ego und Status
Gerade bei dominanten Persönlichkeiten wird das Unternehmen Teil der eigenen Identität.
Eine Veränderung der Beteiligungsverhältnisse, der Geschäftsführung oder gar ein Verkauf wird als persönliche Niederlage empfunden.
Man bleibt lieber im Problem, als den eigenen Einfluss zu verlieren.
Was der Multi-Family Officer sieht:
„In Familiengesellschaften geht es selten nur um Kapital – sondern um Zugehörigkeit, Loyalität und alte Rechnungen.
Ein Sanierungskonzept, das nur auf Zahlen basiert, wird dort scheitern.
Ich sehe es oft: Zwei Geschwister blockieren eine Maßnahme nicht aus Trotz, sondern weil nie geklärt wurde, wer wirklich entscheidet – und was das Unternehmen ihnen bedeutet.
Deshalb gilt: Sanierung braucht nicht nur Strategie, sondern auch Moderation. Wer die emotionale Landkarte ignoriert, übersieht das eigentliche Minenfeld.“
4. Fallstricke in der Praxis: Drei exemplarische Szenarien
Fall 1: Die Familien-GmbH mit drei Erben
Nach dem Tod des Gründers übernehmen drei Geschwister je 33 % der Anteile.
Alle sind beruflich außerhalb des Unternehmens tätig.
In der Krise ist keiner bereit, Kapital nachzuschießen – und keiner will zustimmen, dass ein externer Sanierer mit Sondervollmachten kommt.
Ergebnis: Stillstand. Die Geschäftsführung kündigt.
Nach sechs Monaten muss Insolvenz angemeldet werden.
Fall 2: Der Investor mit Exit-Agenda
Ein Fonds hält 60 % der Anteile, ein Gründer 40 %.
Der Fonds will verkaufen – der Gründer nicht.
Die Sanierung erfordert Investitionen, die den Exit erschweren würden.
Der Fonds blockiert – in der Hoffnung auf ein günstiges Asset-Strip-Modell.
Ergebnis: Die operativ sinnvolle Sanierung scheitert an asymmetrischen Interessen.
Fall 3: Die 25,1 %-Beteiligung mit Vetorecht
Ein strategischer Partner hat sich vor Jahren mit 25,1 % beteiligt – mit umfassenden Vetorechten.
Jetzt wird eine Kapitalerhöhung zur Rettung des Unternehmens benötigt.
Der Partner blockiert – weil er sich verwässert sieht, ohne Einfluss auf die operative Sanierung zu haben.
Ergebnis: Finanzierung scheitert – Insolvenz in Eigenverwaltung folgt.
5. Was hilft: Lösungsansätze auf drei Ebenen
1. Governance vorbereiten – nicht erst im Ernstfall
- Gesellschaftsverträge regelmäßig aktualisieren, auch auf Krisenfestigkeit
- Entscheidungsmechanismen für den Krisenfall definieren
- Sonderrechte auf ihre Wirkung prüfen und ggf. befristen
- Beiräte oder Notfall-Gremien mit definierten Vollmachten einsetzen
2. Psychologische Dynamiken offenlegen und moderieren
- Frühzeitig eine neutrale Moderation einbinden
- Emotionen benennen und entkoppeln von Sachentscheidungen
- Einzelgespräche statt Gruppendruck – um Gesichtsverluste zu vermeiden
- Klar machen: Verzicht ist kein Verlust – sondern Rettungspotenzial.
3. Beteiligung neu strukturieren – wenn nötig auch mit Bruch
- Anteilskäufe oder -verkäufe vorbereiten
- Optionsrechte aktivieren oder nachverhandeln
- notfalls: Squeeze-out, Debt-to-Equity oder Asset-Deal
Wichtig: Nicht aus Trotz – sondern wenn der Erhalt sonst nicht möglich ist
Was ein Minderheitseigner erwarten darf – und geben muss:
„Minderheiten haben ein legitimes Interesse, nicht einfach übergangen zu werden.
Doch sie tragen auch Mitverantwortung, wenn es ums Ganze geht.
Ich sage bewusst: Zustimmung muss verdient werden.
Nicht durch Druck – sondern durch Transparenz, Einbindung und faire Risikoaufteilung.
Wer das als Mehrheit ignoriert, erntet Widerstand.
Wer es als Minderheit ausreizt, riskiert den Untergang des Ganzen.
Worauf es ankommt: Vertrauen, Verlässlichkeit – und ein gemeinsamer Blick nach vorn.
Nicht auf Kontrolle, sondern auf die Substanz.“
6. Fazit: Wer retten will, muss auch loslassen können
Sanierung ist oft eine Frage der Zahlen – aber noch öfter eine Frage der Haltung.
Der häufigste Grund für das Scheitern ist nicht die Bilanz – sondern der unbewegliche Gesellschafterkreis.
Wer zu lange zögert, riskiert alles:
👉 Das Unternehmen.
👉 Die Arbeitsplätze.
👉 Und letztlich: das eigene Vermögen.
Deshalb gilt:
Krisenfest ist nicht, wer alles kontrolliert. Sondern wer weiß, wann Kontrolle losgelassen werden muss.