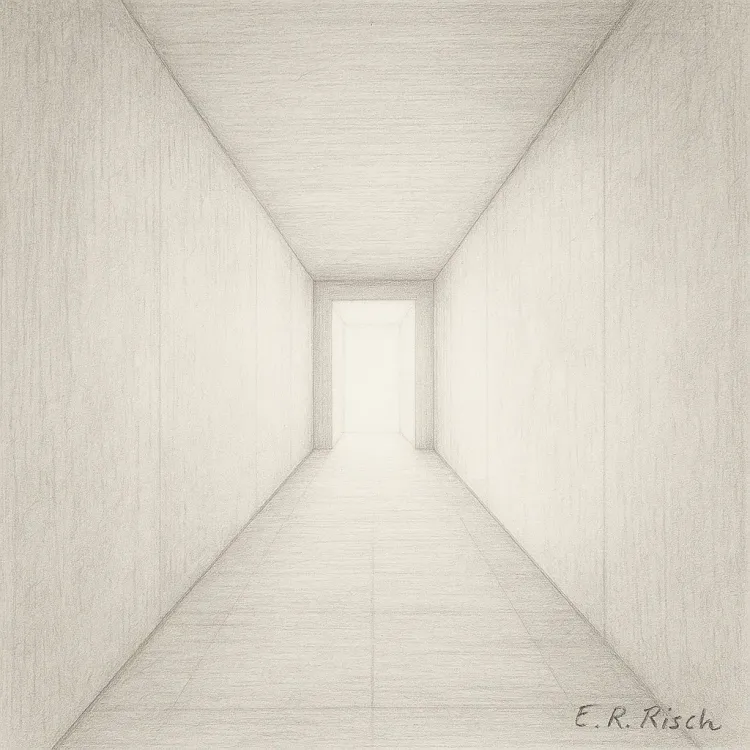Verhandeln in der Krise: Drei Muster, die ich nie mehr übersehe
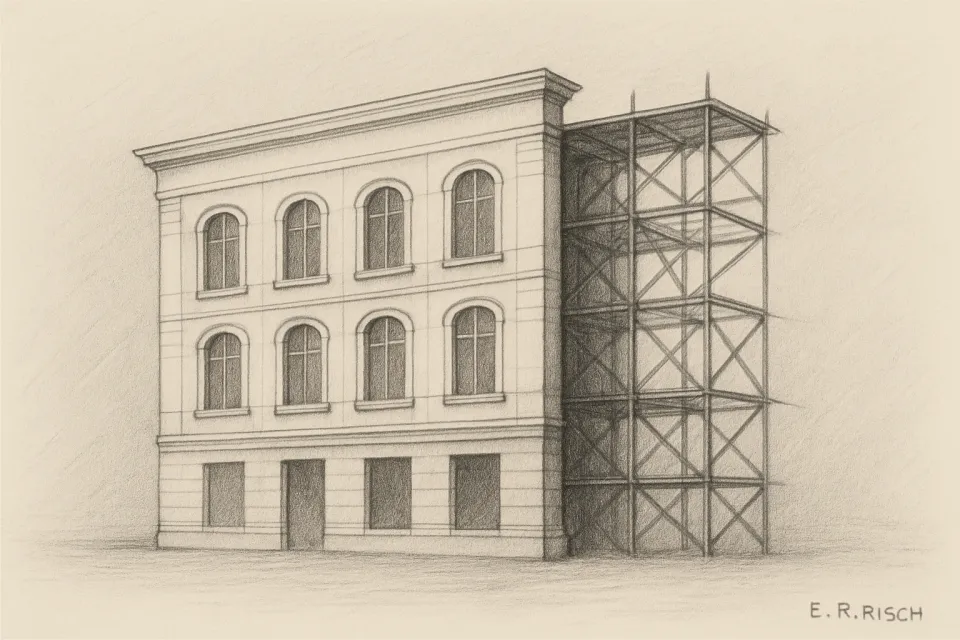
Warum Krisenverhandlungen anders laufen
In der Theorie geht es in Verhandlungen um Interessen, Optionen und faire Lösungen. In der Praxis – besonders in der Krise – geht es um Macht, Tempo, Verunsicherung. Und um viel mehr Emotion, als die meisten zugeben.
Wenn ich eines gelernt habe: Krisen entgrenzen das Spiel.
Was gestern noch als unfair galt, wird heute als „nötig“ verkauft.
Was in ruhigen Zeiten höflich ausgehandelt wird, wird in der Krise inszeniert – oft als alternativlose Entscheidung, möglichst ohne Widerspruch.
Ich habe über die Jahre etliche Verhandlungen in Sondersituationen begleitet:
Distressed M&A, Gesellschafterkonflikte, Turnaround-Mandate, Refinanzierungen.
Und immer wieder bin ich denselben Mustern begegnet – unabhängig von Branche, Beteiligten oder Deal-Größe.
Drei dieser Muster sehe ich heute fast sofort. Und sie sagen mir mehr über den Verlauf der Verhandlung als jedes Zahlenwerk.
Muster #1: Die Illusion des Plan B
„Wir führen auch mit anderen Gespräche…“
Dieser Satz fällt fast immer, wenn eine Seite Druck aufbauen will. Er ist selten konkret. Und fast nie belastbar.
In der Krise funktioniert dieser Trick besonders gut, weil die andere Seite ohnehin unter Strom steht: Man will retten, sichern, reagieren. Die Vorstellung, dass es einen zweiten Bieter, einen alternativen Investor oder einen besseren Sanierer geben könnte, erzeugt Handlungsdruck.
Beispiel aus der Praxis:
Ein Gesellschafter verhandelt mit einem potenziellen Investor über eine Brückenfinanzierung. Plötzlich heißt es: „Ein anderes Family Office hat auch Interesse.“
Nachbohren ergibt: Es gab ein Gespräch. Kein Angebot. Keine Prüfung. Kein ernstzunehmender Fortschritt. Aber genug, um die Verhandlungsdynamik zu verändern.
Warum das gefährlich ist:
- Es verschiebt die emotionale Lage: Man fühlt sich ersetzbar.
- Es untergräbt den inneren Verhandlungsspielraum.
- Es zwingt zu Reaktionen, die man ohne Druck nicht getroffen hätte.
Was hilft:
- Kalt bleiben. Wer eskaliert, spielt dem anderen in die Karten.
- Nachfragen. Wer, wann, mit welchem Scope?
- Verbindlichkeit einfordern. Wer Alternativen hat, muss sie nicht andeuten – er kann sie beweisen.
Merksatz:
Wer blufft, kann selten liefern. Wer liefert, muss nicht bluffen.
Muster #2: Das Pseudo-Wir
„Wir sitzen doch alle im selben Boot…“
Nein. Tun wir nicht.
In der Krise wird gerne auf das Wir-Gefühl gesetzt – als moralischer Hebel, als Harmoniesignal, als Einigungsversprechen. Das Problem: Das vermeintliche „Wir“ dient oft der Verschleierung asymmetrischer Interessen.
Typisches Szenario:
Ein Sanierungsberater wird vom Unternehmen beauftragt, redet aber vor allem mit den Banken.
Ein Geschäftsführer spricht von „gemeinsamem Überleben“, pokert aber im Hintergrund um einen persönlichen Management-Buy-Out.
Ein Hauptgesellschafter verspricht Einigkeit – und droht intern mit Abspaltung.
Warum das so wirksam ist:
- „Wir“ aktiviert Loyalität.
- Es suggeriert, dass man sich selbst schadet, wenn man widerspricht.
- Es verwischt Verantwortlichkeiten – denn in einem „Wir“ ist keiner konkret zuständig.
Was hilft:
- Interessen explizit machen. Wer vertritt wen? Wer profitiert wann wovon?
- Rollen klären. Wer hat Mandat, wer hat Meinung?
- Nicht auf Aussagen reagieren – sondern auf Verhalten.
Merksatz:
In der Krise zählt kein „Wir“. Es zählt nur: Wer sitzt wo – und wohin will er?
Muster #3: Das erzwungene Dilemma
„Ganz oder gar nicht. Jetzt oder nie.“
Ultimaten sind das älteste Verhandlungsmittel – und in der Krise besonders beliebt.
Warum? Weil sie funktionieren. Nicht, weil sie wahr sind. Sondern weil sie wirken.
Beispiel:
Ein Kreditgeber setzt ein Ultimatum: „Bis Freitag muss eine Einigung stehen – sonst wird die Linie gekündigt.“
Oft ist das Framing falsch: Die Linie könnte gekündigt werden, aber nicht ohne weitere Abstimmungen, formale Prüfungen oder Zustimmung aus der Zentrale.
Trotzdem entsteht Druck – und dieser Druck bringt die Gegenseite zu überhasteten Zugeständnissen.
Weitere Beispiele:
- Berater drohen mit Rückzug („Wenn wir das jetzt nicht festzurren, springen unsere Leute ab…“)
- Investoren setzen Deadlines, die sie selbst nicht einhalten müssen
- Verhandlungsführer bauen Entscheidungsschluchten – entweder du springst, oder du bist raus
Was hilft:
- Der Mut, zu vertagen.
- Die Fähigkeit, in Szenarien zu denken – statt im Entweder-oder.
- Die eigene Souveränität: Wer Angst hat, verliert. Wer Raum schafft, gewinnt.
Merksatz:
Dringlichkeit ist selten objektiv. Sie ist oft ein Konstrukt.
Was ich heute anders mache
Ich höre anders.
Ich frage gezielter.
Ich nehme Druck nicht mehr persönlich – sondern erkenne ihn als Werkzeug.
In der Krise zählen nicht nur Argumente. Sondern Struktur.
Nicht nur Lösungen. Sondern Standfestigkeit.
Nicht nur Fakten. Sondern Mustererkennung.
Diese drei Verhandlungsmuster haben sich für mich über Jahre immer wieder bewahrheitet. Und ich glaube: Wer sie erkennt, verhandelt auf Augenhöhe – selbst in der Schieflage.