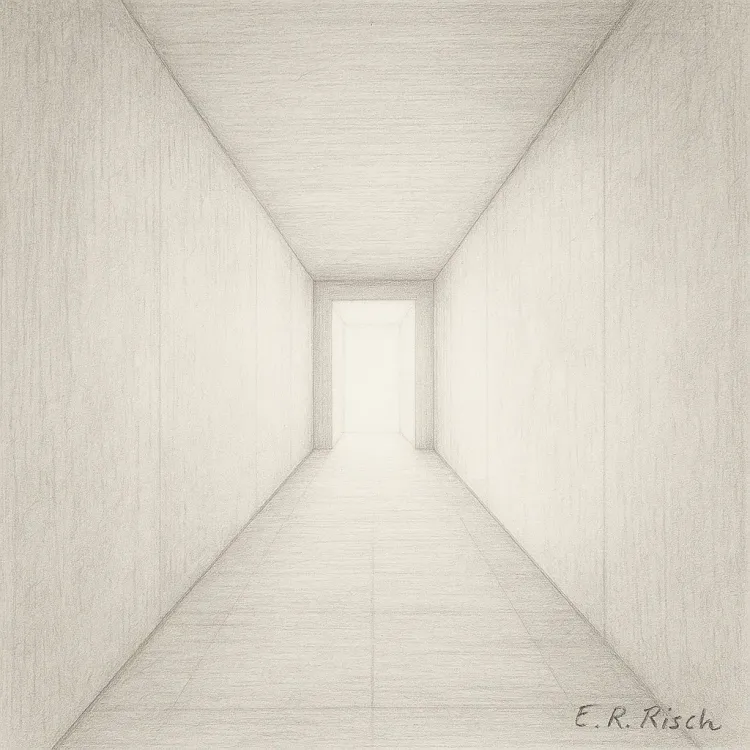Warum manche Sanierungen scheitern – obwohl alles auf dem Tisch liegt
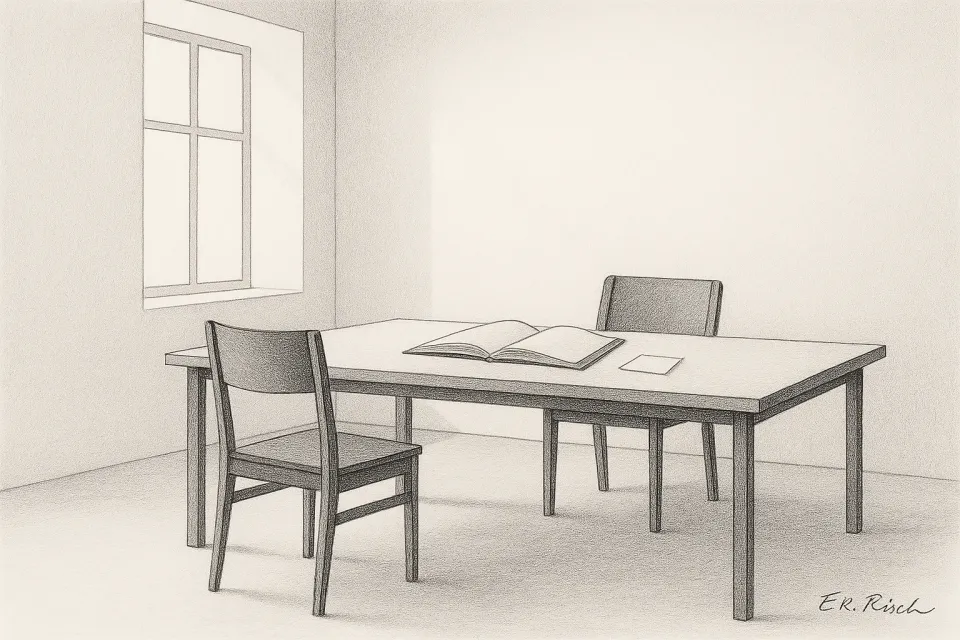
Die Ausgangslage: Hoffnung auf einen Turnaround
Es war kein aussichtsloser Fall. Das Unternehmen – ein Anbieter im Bereich Business Aviation – hatte zwar strukturelle Schwächen, aber auch Potenzial. Eine starke Marke, namhafte Kunden, erfahrene Crews und ein operativ tragfähiges Geschäftsmodell.
ein auf Sondersituationen spezialisierter Investor übernahm 51 % der Anteile, strategisch abgestimmt mit dem bisherigen Mehrheitseigentümer: einer saudischen Unternehmerfamilie. Ziel war es, durch operative Maßnahmen, neue Governance und frisches Management einen Turnaround einzuleiten.
Ich war Teil des Kernteams – verantwortlich für die Analyse, Steuerung und Umsetzung auf Vorstandsebene. Meine Rolle: Corporate Secretary und Strategiekoordinator mit Board-Mandat. Alle drei Wochen war ich eine Woche vor Ort, um mit dem neuen Team in Lissabon zu arbeiten.
Der Plan: operativ stabilisieren, finanziell erneuern
Die Analyse war eindeutig. Die operativen Probleme – unklare Prozesse, unzureichende IT, mangelnde Kommunikation zwischen Stationen – ließen sich lösen. Innerhalb weniger Wochen war ein neues Team etabliert, Prozesse wurden gestrafft, Kosten gesenkt, Verlässlichkeit erhöht. Kundenbeziehungen konnten gesichert werden.
Das strukturelle Problem lag tiefer: Die Flotte war überaltert, der Investitionsstau enorm, Wartungen verschleppt. Lieferanten lieferten nur noch gegen Vorkasse, einige Leasinggeber drohten mit Rücknahmen.
Wir quantifizierten den Bedarf offen und präzise: Zwischen 20 und 40 Millionen CHF wären erforderlich gewesen, um die operative Plattform nachhaltig zu sichern und regulatorische Risiken auszuschließen.
Die Zahlen waren klar. Die Strategie stand. Das Team war bereit.
Und trotzdem scheiterte alles.
Der wahre Grund: verdeckte Obstruktion
Was nach außen wie ein geordneter Sanierungsprozess wirkte, war intern überlagert von einem subtilen, aber wirkmächtigen Gegenspieler: dem Vertreter des zweiten Großaktionärs.
Ein Mann mit exzellentem Auftreten, langer Historie in Finanzfragen – und enormem informellen Einfluss auf die Gesellschafter. Über Jahre hatte er die finanzielle Realität schöngerechnet oder aktiv verschleiert. Wartungsstau? Angeblich übertrieben. Kapitalbedarf? Dramatisierung. Investitionsbedarf? Temporär.
Als unsere Analyse auf den Tisch kam, begann das eigentliche Ringen:
- Er relativierte Zahlen, stellte Fragen ohne Substanz, forderte absurde Annahmen.
- Er kommunizierte selektiv mit Eigentümern und Gremien – hinter unserem Rücken.
- Er baute systematisch Zweifel auf, ohne selbst Alternativen anzubieten.
- Er verzögerte Entscheidungen, indem er auf angeblich neue Erkenntnisse verwies.
Und das Schlimmste: Er trat dabei nicht offen in Opposition, sondern taktierte aus dem Hintergrund. Für Außenstehende wirkte es, als gäbe es „nur noch Klärungsbedarf“. Tatsächlich wurden wir systematisch entmachtet, ohne dass jemand offen Verantwortung übernahm.
Die Symptome: das Team verliert Halt
Was passiert, wenn ein Team operativ stark arbeitet, aber auf politischer Ebene untergraben wird?
- Gute Leute werden vorsichtig. Sie stellen sich selbst infrage.
- Momentum geht verloren – weil Entscheidungen verzögert oder entwertet werden.
- Vertrauen bröckelt – in die Führung, in den Sinn des eigenen Tuns.
- Talente springen ab – die Fähigen gehen zuerst.
Auch bei uns war das spürbar. Trotz aller Fortschritte spürte das Team: Es fehlt die politische Rückendeckung. Es fehlt die echte Entscheidungskraft. Die Luft wurde dünner.
Der Moment der Wahrheit
Wir wussten: Wenn keine Entscheidung für die Finanzierung fällt, ist das Projekt verloren. Also legten wir noch einmal alle Karten offen. Szenarien. Pläne. Zahlungsflüsse. Risikobewertungen. Alles.
Und wieder: keine Entscheidung. Keine verbindliche Antwort. Keine Ablehnung – aber auch keine Zusage. Stattdessen: erneutes Hinterfragen, neue Prüfaufträge, interne Gespräche im Eigentümerkreis.
So verliert man Zeit. Und Vertrauen. Und Chancen.
Am Ende stand fest: Der bestehende Hauptgesellschafter würde keine Mittel nachschießen. Externe Finanzierung war aufgrund des Zustands der Flotte und der intransparenten Governance-Struktur nicht möglich. Die Insolvenz war unausweichlich.
Die eigentliche Lehre
Es war kein operatives Scheitern. Es war ein Governance-Versagen.
Die Analyse war sauber. Der Turnaround möglich. Aber die Strukturen gaben dem restrukturierenden Team keine echte Machtbasis.
Wir waren von Anfang an politisch unterlegen – nicht inhaltlich, sondern durch verdeckte Netzwerke, Loyalitäten und die Unfähigkeit der Gremien, klare Verhältnisse zu schaffen.
Eine Restrukturierung ohne klares Mandat und geschützte Umsetzungsverantwortung ist wie Fliegen mit offenen Tanks: Irgendwann wird der Absturz unvermeidlich.
Was heißt das für Restrukturierer?
Aus meiner Sicht braucht jede Sanierung drei Voraussetzungen – nicht inhaltlich, sondern strukturell:
- Ein eindeutiges Mandat mit Entscheidungsbefugnis und Budgetverantwortung
- Klare Kommunikationswege, in denen Widersprüche sichtbar gemacht und geklärt werden
- Schutz vor verdeckter Obstruktion, z. B. durch definierte Entscheidungsmechanismen oder Eskalationsrechte
Fehlt eines davon, wird jede Analyse – so gut sie auch sein mag – zu Papier.
Persönliche Reflexion
Ich bin kein Freund von Schuldzuweisungen. Aber ich bin ein Freund von Klarheit. Und in diesem Fall war klar:
- Der Kapitalbedarf war früh benannt.
- Die Ursachen waren systematisch analysiert.
- Die Maßnahmen klar priorisiert.
Was fehlte, war der politische Wille zur Entscheidung. Und die Bereitschaft, einen vertrauten, aber blockierenden Akteur zu entmachten.
Das sollte nie wieder passieren – weder mir, noch anderen.
Was andere daraus mitnehmen können:
Für Aufsichtsgremien und Beiräte:
Nehmt politische Dynamiken ernst. Analysiert nicht nur Zahlen, sondern auch Personen.
Für CFOs und Geschäftsführer:
Schafft Transparenz. Und fordert Schutz, wenn ihr in die Umsetzung geht.
Für Restrukturierer:
Prüft die Mandatslage. Und sprecht Konflikte früh an – auch wenn es unbequem ist.
Für Investoren:
Klare Ownership-Strukturen sind kein Luxus – sie sind Überlebensvoraussetzung.
Krisenpsychologie & Governance: Das Unsichtbare sichtbar machen
In der Sanierung arbeiten wir oft an Systemen, Zahlen, Strukturen. Aber der wahre Hebel liegt woanders:
- Wer entscheidet wirklich?
- Wer wird gehört – und wer nicht?
- Wer blockiert – aber tut so, als wäre er neutral?
- Wer hat die Macht, Dinge zu verzögern, ohne je Verantwortung zu übernehmen?
Diese Fragen entscheiden über Erfolg oder Misserfolg.
Wir brauchen in Turnaround-Situationen mehr als operative Exzellenz. Wir brauchen:
- politische Klarsicht,
- psychologische Sensibilität,
- strukturellen Schutz.
Nur dann gelingt, was auf dem Papier längst stimmt.
Und jetzt?
Ich teile diesen Fall nicht aus Groll. Sondern aus Überzeugung, dass wir ehrlicher über die Dynamiken sprechen müssen, die Restrukturierungen in der Realität prägen.