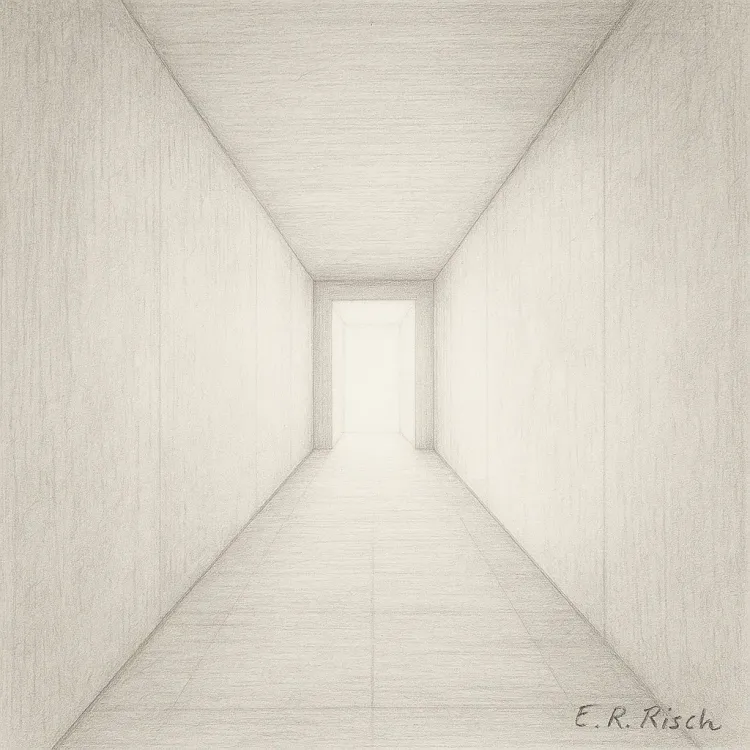Wie wir in Krisen falsch führen – und was das mit Kultur zu tun hat
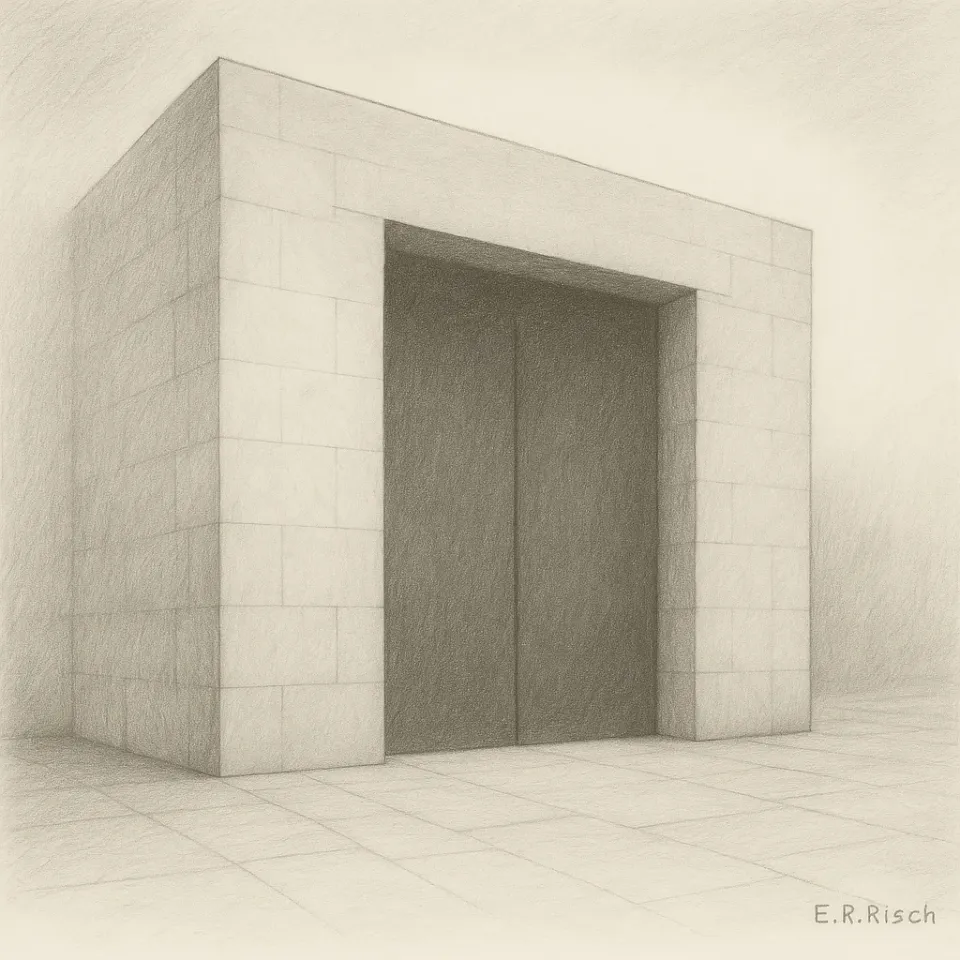
Warum Führung in der Krise oft scheitert – und was wir daraus lernen können.
Es gibt diesen einen Moment in fast jedem Krisenprojekt:
Die Stimmung ist angespannt. Zahlen brechen ein. Alle schauen auf den CEO – oder den Inhaber. Und was passiert?
Entweder: hektische Betriebsamkeit. Oder lähmendes Schweigen.
Beides ist nachvollziehbar. Und beides ist gefährlich.
Krisen sind ein Spiegel
Wenn ich in Krisen geholt werde, treffe ich oft auf gute Leute: kluge Köpfe, engagierte Teams, leistungsbereite Führungskräfte. Aber trotzdem läuft etwas grundlegend schief. Nicht in der Strategie, nicht im Markt – sondern im Verhalten.
Führung in der Krise scheitert selten an fehlendem Wissen.
Sie scheitert am falschen Umgang mit Unsicherheit, Angst und Verantwortung.
Und damit auch: an Kultur.
Denn Kultur zeigt sich nicht auf dem Papier, sondern im Verhalten unter Druck.
Warum wir in der Krise anders führen (und oft schlechter)
In der Krise verändert sich alles:
Der Horizont wird kürzer. Die Fehlerkosten steigen. Der Rechtfertigungsdruck wächst.
Und plötzlich greifen viele Führungskräfte auf Muster zurück, die in normalen Zeiten verdeckt bleiben:
- Kontrolle statt Vertrauen
- Schuldzuweisung statt Verantwortung
- Mikromanagement statt Klarheit
- Meetings statt Entscheidungen
Nicht, weil sie es böse meinen.
Sondern weil sie selbst im Stressmodus sind.
Fight – Flight – Freeze. Nur mit Anzug und Outlook-Kalender.
Ein persönlicher Aha-Moment
Ich erinnere mich gut an ein Projekt, bei dem wir mit einem Unternehmen in der Industrie arbeiteten. Die Zahlen waren schlecht, aber nicht hoffnungslos. Die Lage war ernst – aber lösbar.
Und trotzdem wirkte die Geschäftsführung, als wäre sie im freien Fall. Entscheidungen wurden ständig vertagt. Die Mitarbeiter bekamen widersprüchliche Signale. Und intern lief ein Machtkampf, wer „eigentlich schuld“ war.
Einer der Bereichsleiter sagte damals in einem vertraulichen Gespräch einen Satz, der sich mir eingebrannt hat:
„Wir reden über Liquidität – aber keiner spricht über Angst.“
Genau das war der Punkt. Die Zahlen waren das eine.
Die eigentliche Krise war emotional.
Was Krise mit Kultur macht – und umgekehrt
Krisen sind der ultimative Belastungstest für jede Unternehmenskultur.
Und gleichzeitig: ein Verstärker aller blinden Flecken.
Eine toxische Kultur wird in der Krise sichtbarer.
Aber auch gute Kulturen können zerbrechen, wenn Führung versagt.
Besonders fatal ist die Kombination aus:
- Kultur der Harmonie, bei der Konflikte unterdrückt werden
- Führung aus Unsicherheit, bei der Klarheit fehlt
- Mitarbeiter in Angst, die sich selbst schützen müssen
Das Ergebnis: Schweigen. Rückzug. Schattenorganisation.
Die eigentlichen Themen werden nicht besprochen. Entscheidungen werden durchgewunken oder blockiert. Und wer etwas sagt, wird als Störfaktor gesehen – nicht als Helfer.
Führung in der Krise braucht ein anderes Mindset
Wer in der Krise führt, braucht mehr als nur operative Stärke.
Er oder sie braucht emotionale Klarheit.
Und das beginnt bei einem selbst.
Was spüre ich – und wie reagiere ich?
Was sende ich aus – auch nonverbal?
Was löse ich im Team aus – Angst oder Vertrauen?
Ich habe in den letzten Jahren eine einfache Faustregel entwickelt:
Je stiller das Team – desto größer der Führungsfehler.
Denn Schweigen ist nie neutral. Es ist ein Symptom.
Für Unsicherheit, für Vertrauensverlust – oder für Angst.
Was hilft? Fünf Impulse aus der Praxis
Hier sind fünf Dinge, die ich aus der Arbeit in Krisenteams gelernt habe – nicht aus Lehrbüchern, sondern aus echten Situationen:
1. Nenn die Lage beim Namen – aber ohne Drama
Viele versuchen, die Situation zu beschönigen („Wir haben ein paar Herausforderungen…“) oder zu dramatisieren („Wenn wir jetzt nichts tun, sind wir bald tot“). Beides ist falsch.
Gute Krisenführung beginnt mit Ehrlichkeit. Sachlich. Klar. Ohne Panik.
„Ja, wir stehen unter Druck. Aber wir sind nicht handlungsunfähig.“
Diese Klarheit wirkt. Weil sie Führung zeigt – und keine Show.
2. Kläre, was du (nicht) kontrollieren kannst
In der Krise wollen viele alles kontrollieren – und verlieren dabei den Blick für das Wesentliche. Die Kunst liegt darin, bewusst zu priorisieren:
- Was kann ich beeinflussen?
- Was ist extern – und muss als Unsicherheit akzeptiert werden?
- Wo braucht es jetzt Entscheidungen – auch mit 70 % Infos?
Diese Art zu führen ist nicht heroisch. Sondern verantwortungsvoll.
3. Sprich über Emotionen – ohne esoterisch zu werden
Viele Führungskräfte haben Angst vor emotionaler Sprache.
Aber gerade in der Krise brauchen Menschen Worte für das, was sie erleben.
Das bedeutet nicht, Gruppentherapie zu machen. Sondern: emotional präsent zu sein.
Ein einfaches Beispiel:
„Ich sehe, dass viele von euch verunsichert sind. Das ist normal. Ich bin es auch manchmal. Aber wir bleiben handlungsfähig.“
Dieser Satz verändert Räume. Weil er ehrlich ist – und verbindet.
4. Kultur braucht Sprache – auch (und gerade) in der Krise
In der Krise verengen sich Gespräche schnell auf Zahlen und Maßnahmen. Aber genau dann braucht es kulturelle Reflexion.
- Wie sprechen wir miteinander – unter Druck?
- Wie gehen wir mit Fehlern um?
- Wie viel Ehrlichkeit halten wir aus?
Wenn Kultur kein Thema ist, wird sie zum Problem.
Wer sie aktiv gestaltet, macht sie zur Ressource.
5. Führung heißt, zuerst bei sich selbst zu beginnen
Vielleicht der schwierigste Punkt – und doch der wichtigste:
Krisenführung beginnt nicht mit Tools, sondern mit Haltung.
- Was glaube ich über Führung?
- Was bin ich bereit zu zeigen – auch von meiner Unsicherheit?
- Wie bleibe ich bei mir, wenn andere eskalieren?
Wer in der Krise stabil führen will, braucht kein perfektes Konzept.
Aber er oder sie braucht einen inneren Kompass.
Und was hat das alles mit Kultur zu tun?
Mehr als wir denken.
Denn wie wir führen, wenn es brennt – sagt mehr über unsere Kultur als jede Vision, jeder Leitwert und jedes Onboarding-Video.
- Eine Kultur der Angst zeigt sich in Schuldzuweisungen.
- Eine Kultur der Verantwortung zeigt sich in Klarheit.
- Eine Kultur des Vertrauens zeigt sich im Dialog – auch wenn’s weh tut.
Kultur ist nicht weich. Kultur ist wirksam.
Gerade in der Krise.
Ein Blick nach Japan (oder: Was wir von anderen lernen können)
In Japan gibt es ein Konzept namens „Gambaru“.
Es bedeutet: weiterkämpfen – auch wenn es schwer ist. Nicht blind. Nicht verbissen. Sondern würdevoll.
Diese Haltung prägt viele japanische Unternehmen. In Krisen wird nicht laut geklagt. Aber auch nicht verdrängt. Sondern: verantwortlich gehandelt.
Und es gibt Rituale, die helfen: Stille Besprechungen. Klare Sprache. Gemeinsames Aushalten von schwierigen Entscheidungen. Kein Fingerzeigen – sondern Fokus.
Natürlich kann man das nicht 1:1 übertragen. Aber es zeigt: Kultur ist gestaltbar.
Und sie beginnt nicht im Vorstand, sondern im täglichen Tun.
Schlussgedanke: Die Krise als Kulturtest
Ich glaube nicht, dass Krisen automatisch Gutes hervorbringen.
Aber sie zeigen, was da ist – oder fehlt.
Und genau darin liegt die Chance:
Führung neu zu denken. Kultur neu zu leben. Und gemeinsam durch Unsicherheit zu gehen – nicht perfekt, aber bewusst.
Denn am Ende entscheidet nicht der Sanierungsplan über den Erfolg.
Sondern das, was zwischen den Menschen passiert.
Kultur entscheidet, ob wir durch die Krise führen – oder nur reagieren.